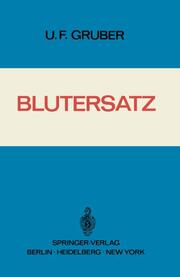Detailansicht
Blutersatz
ISBN/EAN: 9783540041252
Umbreit-Nr.: 4371361
Sprache:
Deutsch
Umfang: xv, 271 S.
Format in cm:
Einband:
kartoniertes Buch
Erschienen am 01.01.1968
Auflage: 1/1968
- Zusatztext
- Die mannigfachen Schockprobleme bleiben aktuell, weil Diagnose und Therapie des "Schwerkranken" fast monatlidt Bereicherungen erfahren. Allein in den 5 Zeitschriften, die in den letzten Tagen auf meinen Sdtreib tisch gelangt sind, finden sich nidtt weniger als 10 interessante Arbeiten iiber Fragen der Schockforschung (siehe Literatur 41 b, 53 a, 60 a, 192 a, 242 a, 350 b, 810 a, 941 a, 1069 a, 1082 a). Wichtigstes Anliegen bleibt es, den objektiven Katalog der verschiedenen Schockmanifestationen in Klinik und Experiment moglichst vollstandig zu machen - Interpretationen dieser Phanomene aber in ihrer relativen und zeitgebundenen "Wahrheit" zu sehen. Probleme der Schockforschung sind nicht nur von wissenschaftlichem Interesse, sondem auch von groBer klinischer Bedeutung. Insbesondere wer den fast aIle praktisch tatigen Krzte immer wieder mit Fragen des Blut ersatzes konfrontiert. Ein wichtiges theoretisches und therapeutisches Pro blem der Schockforschung bleibt das effektive oder zirkulierende Blutvolu men. U. F. GRUBER hat seit Jahren diese Frage klinisch und experimentell verfolgt. Das vorliegende Werk setzt sich in auBerordentlidt griindlicher Weise mit der Weltliteratur auseinander. Eine langere Reihe eigener Arbeiten bei F. D. MOORE in Boston, an der chirurgischen Abteilung in Chur, bei L. E. GELIN und S. E. BERGENTZ in Goteborg sowie im Laboratorium fUr experimentelle Chirurgie in Davos nimmt dieser Sicht den Charakter einer Kompilation, weil auf Grund eigener Untersuchungen ein Urteil gewagt und Wesentliches yom Unwesentlichen unterschieden wird.
- Kurztext
- InhaltsangabeErster Teil: Pathophysiologie des Blutverlustes.- A. Pathophysiologie des hämorrhagischen Schocks.- B. Spontane Regulationsvorgänge des Organismus nach Blutverlust.- I. Verluste von 500 bis 1000 ml Blut.- II. Größere Blutverluste.- C. Probleme des Sauerstofftransportes.- I. Ruhebedingungen.- II. Bedrohung einer ausreichenden Sauerstoffversorgung.- III. Notwendigkeit des Ersatzes von Erythrocyten.- IV. Beurteilung der Sauerstoffversorgung des Körpers.- V. Strömungseigenschaften des Blutes.- VI. Wie weit darf das Blutvolumen durch erythrocytenfreie Lösungen aufgefüllt werden?.- D. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen: Pathophysiologie des Blutverlustes.- Zweiter Teil: Die verschiedenen Möglichkeiten des Volumenersatzes.- A. Volumenersatz durch Blut.- I. Nachteile und Gefahren der Bluttransfusion.- 1. Mortalität.- 2. Die Übertragung von Krankheiten.- a) Häufigkeit der Transfusionshepatitis.- b) Letalität der Transfusionshepatitis.- c) Maßnahmen zur Verhütung der Transfusionshepatitis.- 3. Reaktionen durch bakterielle Verunreinigungen.- 4. Inkompatibilität.- 5. Hämolytische Reaktionen.- 6. Allergische Reaktionen.- 7. Citrattoxicität.- 8. Acidität von Konservenblut.- 9. Temperaturabfall nach Zufuhr größerer Mengen von kaltem Blut.- 10. Blutgerinnungsstörungen nach massiven Bluttransfusionen.- 11. Kaliumintoxikation.- 12. Ammoniakvergiftung.- 13. Posttransfusionelle Hyperbilirubinämie.- 14. Verschiedene andere Faktoren.- 15. Verminderung der bakteriellen Resistenz.- 16. Beeinträchtigung der Strömungseigenschaften des Blutes.- 17. Überlebensdauer transfundierter Erythrocyten.- II. Der Volumeneffekt von Bluttransfusionen: Therapeutische Resultate.- III. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen: Volumenersatz durch Blut.- B. Volumenersatz durch Plasma.- I. Die verschiedenen Plasmapräparate.- 1. Frischplasma.- 2. Bei 32° C gelagertes Poolplasma (gealtertes Plasma).- 3. Humantrockenplasma = HTP.- 4. Pasteurisierte Plasmaproteinlösung = PPL II.- 5. Albumin.- II. Der Volumeneffekt von Plasma.- 1. Frischplasma.- 2. Gelagertes Poolplasma.- 3. Trockenplasma.- 4. Pasteurisierte Plasmaproteinlösung.- 5. Albumin.- III. Therapeutische Resultate.- IV. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen: Volumenersatz durch Plasma.- C. Volumenersatz durch künstliche kolloidhaltige Infusionslösungen.- I. Einleitung.- II. Terminologie.- III. Anforderungen an künstliche kolloidhaltige Infusionslösungen.- IV. Physikalisch-chemische Charakterisierung künstlicher Kolloide.- 1. Molekulargewicht.- 2. Viscosität.- V. Die verschiedenen künstlichen Kolloide.- 1. Dextran.- a) Definition.- b) Allgemeine Vorbemerkungen zur Beurteilung der Dextranliteratur.- c) Die verschiedenen Dextranpräparate.- d) Kompatibilität von Macrodex und Rheomacrodex mit Medikamenten.- e) Kolloidosmotischer Druck und Effekt, Wasserbindungskapazität.- f) Stoffwechsel.- g) Plasmakonzentration, Ausscheidung im Urin, Nierenfunktion.- h) Histologische Untersuchungen.- i) Immunologische Untersuchungen.- k) Allergische Reaktionen.- 1) Beeinflussung der Senkungsgeschwindigkeit, aggregierende und disaggregierende Eigenschaften.- m) Beeinflussung der Viscosität.- n) Beeinflussung der Blutgruppenbestimmung.- o) Beeinflussung der Infektabwehr und unspezifischen Resistenz.- p) Cancerogenität.- q) Beeinflussung der Blutgerinnung.- r) Pharmakologische Eigenschaften.- s) Beeinflussung von Laboruntersuchungen.- t) Stabilität während der Lagerung.- u) Der Volumeneffekt von Dextran.- v) Hämodynamik.- w) Therapeutische Resultate.- x) Zusammenfassung und Schlußfolgerungen: Volumenersatz durch Dextran.- 2. Gelatine.- a) Definition.- b) Allgemeine Vorbemerkungen zur Beurteilung der Gelatineliteratur.- c) Die verschiedenen Gelatinepräparate.- d) Kompatibilität von Gelatinepräparaten mit Medikamenten.- e) Kolloidosmotischer Druck und Effekt, Wasserbindungskapazität.- f) Stoffwechsel.- g) Plasmakonzentration, Ausscheidung im Urin, Nierenfunktion.- h) Histologische Untersuchungen.- l) Immunologische Untersuchungen.- k) Allergis