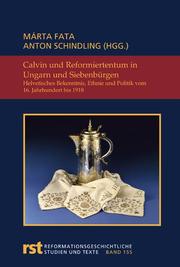Detailansicht
Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen
Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918 - Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 155, Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 155
ISBN/EAN: 9783402115800
Umbreit-Nr.: 1062353
Sprache:
Deutsch
Umfang: XX, 448 S., mit Abb.
Format in cm: 4.4 x 23.6 x 17
Einband:
gebundenes Buch
Erschienen am 11.03.2011
Auflage: 2/2011
- Zusatztext
- Die internationalen und deutschen calvinistischen Forschungen konzentrieren sich bis heute fast ausschließlich auf West- und Mitteleuropa und klammern die ostmitteleuropäischen historischen Regionen wie Polen, das Königreich Ungarn oder das Fürstentum Siebenbürgen aus. Die beiden Herausgeber des Tübinger Tagungsbandes nahmen das Calvin-Jubiläum zum Anlass, um die Frage nach der Wirkungsgeschichte der von dem Genfer Reformator und von den Zürcher Theologen im 16. Jahrhundert grundlegend geprägten theologischen Bewegung, des Reformiertentums / Calvinismus, im ostmitteleuropäischen Raum zu stellen. Über die europäischen Gemeinsamkeiten hinaus kann nämlich der Calvinismus in Ungarn und Siebenbürgen Spezifika aufweisen, die zugleich seinen besonderen Stellenwert im europäischen Vergleich ausmachen. Die besondere Insel- und Peripherielage prägte dem ungarischen und siebenbürgischen Protestantismus und darin dem Calvinismus aus theologisch-dogmatischer Sicht eigene Merkmale auf. So erfolgte der Weg zum Calvinismus in Ungarn und Siebenbürgen nicht durch Calvin, sondern durch Melanchthon an der Universität Wittenberg und vor allem den Züricher Theologen Heinrich Bullinger. Aus der Tatsache, dass das mittelalterliche Königreich Ungarn ein multiethnisches Reich darstellte, konnte zwar im 16. Jahrhundert ein enger Zusammenhang zwischen Konfessionen und Ethnien entstehen; allerdings muss dieses von der älteren Forschung tradierte schematische Bild bei eingehender Analyse revidiert werden. Das helvetische Bekenntnis war auch unter den Slowaken, Rumänen und Deutschen anzutreffen. In der Konstellation der während der ganzen Neuzeit miteinander konkurrierenden Konfessionen in Ungarn und Siebenbürgen konnte zwar der Calvinismus ein besonderes Ansehen erlangen und sogar bis heute bewahren. Doch gerade die im Band dargestellten neuen Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass die These, wonach nur der Calvinismus die ständischen Freiheiten mit der Religionsfreiheit erfolgreich verbinden konnte, nicht aufrechtzuerhalten ist.
- Kurztext
- Die internationalen und deutschen calvinistischen Forschungen konzentrieren sich bis heute fast ausschließlich auf West- und Mitteleuropa und klammern die ostmitteleuropäischen historischen Regionen wie Polen, das Königreich Ungarn oder das Fürstentum Siebenbürgen aus. Die beiden Herausgeber des Tübinger Tagungsbandes nahmen das Calvin-Jubiläum zum Anlass, um die Frage nach der Wirkungsgeschichte der von dem Genfer Reformator und von den Zürcher Theologen im 16. Jahrhundert grundlegend geprägten theologischen Bewegung, des Reformiertentums / Calvinismus, im ostmitteleuropäischen Raum zu stellen. Über die europäischen Gemeinsamkeiten hinaus kann nämlich der Calvinismus in Ungarn und Siebenbürgen Spezifika aufweisen, die zugleich seinen besonderen Stellenwert im europäischen Vergleich ausmachen. Die besondere Insel- und Peripherielage prägte dem ungarischen und siebenbürgischen Protestantismus und darin dem Calvinismus aus theologisch-dogmatischer Sicht eigene Merkmale auf. So erfolgte der Weg zum Calvinismus in Ungarn und Siebenbürgen nicht durch Calvin, sondern durch Melanchthon an der Universität Wittenberg und vor allem den Züricher Theologen Heinrich Bullinger. Aus der Tatsache, dass das mittelalterliche Königreich Ungarn ein multiethnisches Reich darstellte, konnte zwar im 16. Jahrhundert ein enger Zusammenhang zwischen Konfessionen und Ethnien entstehen; allerdings muss dieses von der älteren Forschung tradierte schematische Bild bei eingehender Analyse revidiert werden. Das helvetische Bekenntnis war auch unter den Slowaken, Rumänen und Deutschen anzutreffen. In der Konstellation der während der ganzen Neuzeit miteinander konkurrierenden Konfessionen in Ungarn und Siebenbürgen konnte zwar der Calvinismus ein besonderes Ansehen erlangen und sogar bis heute bewahren. Doch gerade die im Band dargestellten neuen Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass die These, wonach nur der Calvinismus die ständischen Freiheiten mit der Religionsfreiheit erfolgreich verbinden konnte, nicht aufrechtzuerhalten ist.