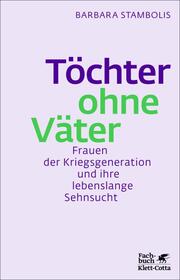Detailansicht
Töchter ohne Väter
Frauen der Kriegsgeneration und ihre lebenslange Sehnsucht
ISBN/EAN: 9783608947243
Umbreit-Nr.: 1394815
Sprache:
Deutsch
Umfang: 315 S., 9 Fotos
Format in cm: 2.6 x 21.1 x 42
Einband:
Paperback
Erschienen am 07.03.2012
Auflage: 1/2012
- Zusatztext
- Vaterlose Töchter fragen nach den Folgen ihres vaterlosen Aufwachsens für sich, ihre Partnerschaften und die eigenen Kinder. Sie sind sicher, ihr Leben wäre anders verlaufen, wenn sie einen Vater gehabt hätten. Eines spüren sie genau: Ihr Selbstwertgefühl hat lebenslang auf unsicherem Grund gestanden und das führen sie auf das Fehlen von väterlichem Halt zurück. "Mit schlechten Karten gut spielen" könnte als Motto über manchen der beeindruckenden Lebenswege stehen. Barbara Stambolis lässt diese Frauen ausführlich zu Wort kommen. Sie analysiert ihre Erfahrungen, ordnet diese zeitgeschichtlich ein und versucht, das Lebensgefühl vaterloser Töchter der Kriegsgeneration auf den Punkt zu bringen. Das Verständnis der tiefen Vater-Sehnsucht der Betroffenen kann therapeutisch wegweisend sein und den vaterlosen Töchtern helfen, positive Perspektiven für ihr Leben im Alter zu entwickeln.
- Kurztext
- Frauen, die kriegsbedingt ohne Väter aufgewachsen sind, wollen die Auswirkungen ihrer Vaterlosigkeit verstehen. Die Autorin analysiert ihr Lebensgefühl. Das Verständnis dieser tiefen Sehnsucht kann therapeutisch wegweisend sein und den vaterlosen Töchtern helfen, positive Perspektiven für ihr Leben im Alter zu entwickeln.
- Autorenportrait
- Barbara Stambolis, Prof. Dr., lehrt an der Fakultät für Kulturwissenschaften der Universität Paderborn Neuere und Neueste Geschichte. Ihren Schwerpunkt bilden kultur-, mentalitäten-, und sozialgeschichtliche Forschungsfelder. Zur Webseite: www.barbara-stambolis.de
- Schlagzeile
- 'Mir hat niemand die Welt erklärt.'
- Leseprobe
- VORWORTAls ich begann, mich intensiv mit Kindheiten im Zweiten Weltkrieg und ihren Folgen zu beschäftigen, stieß ich auf ein Foto aus dem Jahre 1946, das ein etwa fünf oder sechs Jahre altes Kind mit seiner Mutter zeigt. Allein und gleichsam verloren stehen beide auf einer Straße - das greisenhafte Gesicht des Kriegskindes lässt erahnen, dass es eigentlich kein Kind mehr ist. Viele Menschen fühlten sich von diesem Foto angerührt. Die Frage nach dem Schicksal dieses einen Kindes - es ist ein kleiner Junge - lässt sich zwar nicht beantworten, aber sie enthält eine mehr oder weniger versteckte Aufforderung: nämlich her auszunden, was aus den Kindern von damals geworden ist. An diesem Beispiel eines 'Motivs' lässt sich veranschaulichen, wie sich Forschungsfragen entwickeln können. Ein anderer Anstoß, ebenfalls mit einer Frage verbunden, ergab sich aus folgender Beobachtung: Mir el auf, dass in Filmen aus der unmittelbaren Nachkriegszeit Jungen offenbar deutlicher 'im Bild' waren als Mädchen. Warum ? Zunehmend begannen nicht nur Bilder von Mädchen aus der Kriegs- und Nachkriegszeit mein Interesse zu fesseln, sondern es hat sich ein Forschungsthema entwickelt, in dessen Mittelpunkt die Lebensläufe von Frauen stehen, die im Zweiten Weltkrieg und in der Nachkriegszeit auf wuchsen.In dem 2004 erschienenen und mittlerweile in dritter Auage vorliegenden Buch 'Söhne ohne Väter. Erfahrungen der Kriegsgeneration' heißt es: 'Zu den einen Lebenslauf bestimmenden Belastungen [] gehört auch die kriegsbedingte Vaterlosigkeit, die oft die Art und Weise des Her anwachsens der Söhne (und selbstverständlich in spezischer Weise auch der Töchter) entscheidend beeinusst hat' (S. 151). Die Klammer in diesem Satz macht den Forschungsbedarf bezüglich der Frauen ebenso deutlich wie der Hinweis Hartmut Radebolds, der mit Hermann Schulz und Jürgen Reulecke das 'Söhne-Buch' her ausgegeben hat, das weibliche Parallelbuch könne 'nur von betroffenen Töchtern geschrieben werden'. Das Wörtchen 'nur' in diesem Satz mag nicht in der Weise gemeint gewesen sein, dass eine kriegsbedingt vaterlos aufgewachsene Tochter wohl am geeignetsten sei, ein solches 'Töchter-Buch' zu schreiben. Dieses Buch könne und solle jedoch, so deutete ich die Formulierung, von einer Frau geschrieben werden, die zwar nicht der Altersgruppe der Kriegskinder im strengen Sinne zugehörig sein muss, deren professionelle Arbeit aber von Empathie ge gen über den Empfindungen, Verletzungen und lebenslangen Belastungen vaterloser Töchter gekennzeichnet sein sollte. Aber es gab zu dem Zeitpunkt, als mich die vaterlosen Töchter zu faszinieren begannen, noch keinen Versuch einer Zeithistorikerin sich des Themas mit den Methoden der Geschichtswissenschaft anzunehmen. Den Regeln dieser Disziplin zufolge können persönliche Bezüge allenfalls eine nebensächliche, wenngleich nicht ganz zu leugnende Rolle spielen. Zentral ist vielmehr die Her ausforderung, den Erfahrungen, Wahrnehmungen und subjektiven Rückblicken vaterloser Töchter einerseits eine Stimme zu geben, sie aber andererseits auch zeitgeschichtlich zu deuten, einzuordnen und 'Exemplarisches' zu beschreiben. Dass Facetten meiner eigenen Familiengeschichte einen Hintergrund für mein intensives Interesse an dem Thema darstellen, sei an dieser Stelle nur angedeutet. Bekanntlich sprechen Historiker und Historikerinnen, um ihre Professionalität zu betonen, nicht von sich selber, aber sie können vielleicht zugestehen, dass sie manchmal aufgrund eigener Erfahrungen in einer besonderen Weise beobachten, Zeitzeugen zuhören oder ein Gespür dafür entwickeln, was es z. B. heißt, dass Frauen eine lebenslange Sehnsucht nach einem ihnen liebevoll zugewandten Vater haben. Diese Sehnsucht haben sicher auch Frauen, die erst nach dem Krieg geboren wurden und aus anderen als unmittelbar kriegsbedingten Umständen vaterfern oder vaterlos aufwuchsen.Etwa 120 Betroffene, Frauen, die zwischen 1930 und 1945 gebo ren wurden, die ihre Väter kaum oder gar nicht kennengelernt hatten, haben zwischen 2007 und 2010 ähnlich wie die 44 an dem 'Söhne-Buch' be auch ohne Vater aufgewachsen. Ihren Kindern wird er vielleicht ebenfalls fehlen - aus ganz anderen Gründen als ihnen in ihrer Kindheit. Es können sich deshalb von der vorliegenden Studie auch jüngere Menschen und aus anderen als kriegsbedingten Gründen vaterlos Aufwachsende angesprochen fühlen.Den vaterlosen Töchtern, von denen ich manchen im Laufe der vergangenen Jahre wiederholt begegnet bin, die sich immer wieder meldeten und Informationen und Überlegungen nachtrugen, die nicht zuletzt zu langen Gesprächen bereit waren, sei an erster Stelle gedankt. Ohne diese Art der Kommunikation und ständigen Anregung wäre das Buch nicht entstanden. Ich hoffe, dass sie sich mit ihren Stärken ebenso dar in wiedernden wie mit ihren Zweifeln, Sehnsüchten und Unsicherheiten.Dass die Gerda-Henkel-Stiftung mir dankenswerterweise ein Forschungsstipendium gewährte, hat maßgeblich die Vor aussetzung für die Auswertung des Materials, für die notwendigen Literaturrecherchen und die Arbeit an der Erstellung des Buchmanuskripts geschaffen. Dem Klett-Cotta Verlag schließlich sei für die gute Zusammenarbeit gedankt. 1 DIE SCHATTEN DER VÄTER 1.1 Töchter ohne Väter melden sich zu Wort'Mein Vater hat durch eine sofort nach meiner Geburt am 7. 11. 1942 abgesandte Postkarte gerade noch von seiner zweiten Tochter erfahren. [] Ich war also noch nicht einmal zwei Monate alt, als meine Mutter die letzte Nachricht von ihm erhielt. So hat mein Vater mich und ich ihn leider niemals gesehen, dann er blieb als Soldat der 6. Armee in Stalingrad vermisst. Das ist etwas, was mich heute noch sehr berührt, den eigenen Vater nie kennengelernt zu haben, ihn mir nie zu eigen machen zu können, ihn nie erlebt zu haben, weil ich nie das Leben mit ihm teilen konnte, auch nicht wenigstens für eine kurze Zeit, so dass ich eine eigene Erinnerung an ihn haben könnte. Meine Schwester und ich würden auch heute noch ein paar Jahre unseres Lebens dafür geben, wenn wir unseren Vater sehen, sprechen und umarmen könnten, um zu erfahren, welch ein Mensch er war und wie er als Vater gewesen wäre.'Mit diesen Worten beginnt eine Frau, die kriegsbedingt vaterlos aufwuchs, eine für ihr Leben grundlegende Verlusterfahrung und eine dar aus erwachsene lebenslange Sehnsucht zu beschreiben. Sie hat mit etwa 120 weiteren vaterlosen Töchtern, alle zwischen 1930 und 1945 geboren, Auskunft über ihren Vater, die Beziehung zu ihrer Mutter und weitere wichtige Prägungen gegeben. Vor allem teilen viele Betroffene das Gefühl, es habe sie bis heute, und d. h. ihr gesamtes bisheriges Leben lang, ein grundlegendes Empnden tiefer Unsicherheit begleitet, verbunden mit einer ebenfalls lebenslangen tiefen Sehnsucht nach väterlichem Halt.Schriftliche Antworten auf einen Fragebogen, längere persönliche Gespräche, viele mündliche Mitteilungen bei Veranstaltungen und teilweise ausführlichere Korrespondenzen sind Grundlage des nun vorliegenden Buches, in dem es um Erfahrungen, Wahrneh...