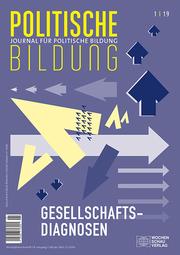Detailansicht
Gesellschaftsdiagnosen
eBook - Journal für politische Bildung 1/2019, Journal für politische Bildung
Dörre, Klaus/Altmeyer, Martin/Reckwitz, Andreas u a
ISBN/EAN: 9783734408298
Umbreit-Nr.: 9068863
Sprache:
Deutsch
Umfang: 80 S., 7.45 MB
Format in cm:
Einband:
Keine Angabe
Erschienen am 18.04.2019
Auflage: 1/2019
E-Book
Format: PDF
DRM: Digitales Wasserzeichen
- Zusatztext
- Unsere "Gesellschaft der Singularitäten" (Andreas Reckwitz) entsteht am Kreuzungspunkt kultureller, ökonomischer und technologischer Wandlungsprozesse und ist durchzogen von Prozessen der Vereinzelung. Spätestens seit den 1990er Jahren befinden wir uns demnach in einer Spätmoderne, in der Besonderheit und Einzigartigkeit herausragende Rollen erhalten. In den 1970er Jahren findet in den westlichen Ländern auch beeinflusst durch die Kulturrevolution der Zeit um 1968 (vgl. Journal 4/18) ein Wandel der leitenden Lebenswerte statt: Anpassung an das Allgemeine verliert an Rückhalt, Entfaltung und Verwirklichung des Selbst gewinnen an Überzeugungskraft das Streben nach einzigartigen, subjektiv befriedigenden Identitäten im Berufsleben, in der Partnerschaft, in der Freizeit und im Konsum eine wahre Selbstverwirklichungsrevolution.Kultureller geht mit ökonomischem Wandel zusammen: Ein Großteil von Wertschöpfung und Erwerbstätigkeit findet sich nun im Dienstleistungssektor. Dies hat Auswirkungen auf Seiten des Konsums wie der Erwerbsarbeit; es findet eine neue Konsumentenrevolution statt, die weniger auf Massenkonsum von Standardgütern setzt als auf symbolische Güter, Erlebnisse, Dienste und mediale Formate in großer Differenziertheit. DIe Entindustrialisierung fördert die Expansion der Wissensökonomie für Hochqualifizierte, eine hochgradig subjektivierte Arbeit im permanenten Wettbewerb um Höchstleistungen: Eine liberalisierte Ökonomie, die nicht nach dem Durchschnitt strebt, sondern nach Exzellenz; die nicht nur Einkommen, sondern auch persönliche Befriedigung verspricht.Die dritte Größe, der laut Reckwitz den Wandel von der Gesellschaft der Gleichen zur Gesellschaft der Singularitäten vorantreibt, ist die digitale Revolution. Die Technik der Industriegesellschaft wirkte standardisierend, die digitale Technologie der Spätmoderne wirkt in mehreren Hinsichten singularisierend. Im Internet findet ein Wettbewerb um Aufmerksamkeit statt, in dem nur Differenz heraussticht, die digitale Welt ist auf das Individuum zugeschnitten. An die Stelle der allgemeinen medialen Öffentlichkeit treten partikulare Communities, die sich jeweils selbst bestätigen. Das verstärkt die Herausforderung des liberalen politischen Systems, auch durch Populismus. Seine Attraktivität gewinnt dieser aus der neuen Spaltungslinie, die zwischen kosmopolitisch orientierten "Liberalisierungsgewinnern" und traditionalistisch eingestellten "Liberalisierungsverlierern" verläuft. Insbesondere diejenigen, die sich als Verlierer der oben beschriebenen Veränderungen sehen und einen ökonomischen und/oder einen kulturellen Verlust fürchten, werden von ihm angesprochen.Gesellschaftsdiagnosen haben Konjunktur und bestimmen den gesellschaftlichen und politischen Diskurs teilweise maßgeblich mit. Diese Ausgabe des Journal benennt gängige Standortbestimmungen, bringt sie mit Phänomenen wie Digitalisierung, Ökonomie und Populismus in Verbindung und versucht, diese für die politische Bildung urbar zu machen.
- Kurztext
- Unsere "e;Gesellschaft der Singularitaten"e; (Andreas Reckwitz) entsteht am Kreuzungspunkt kultureller, okonomischer und technologischer Wandlungsprozesse und ist durchzogen von Prozessen der Vereinzelung. Spatestens seit den 1990er Jahren befinden wir uns demnach in einer Spatmoderne, in der Besonderheit und Einzigartigkeit herausragende Rollen erhalten. In den 1970er Jahren findet in den westlichen Landern - auch beeinflusst durch die Kulturrevolution der Zeit um 1968 (vgl. Journal 4/18) - ein Wandel der leitenden Lebenswerte statt: Anpassung an das Allgemeine verliert an Ruckhalt, Entfaltung und Verwirklichung des Selbst gewinnen an Uberzeugungskraft - das Streben nach einzigartigen, subjektiv befriedigenden Identitaten im Berufsleben, in der Partnerschaft, in der Freizeit und im Konsum - eine wahre Selbstverwirklichungsrevolution. Kultureller geht mit konomischem Wandel zusammen: Ein Groteil von Wertschpfung und Erwerbsttigkeit findet sich nun im Dienstleistungssektor. Dies hat Auswirkungen auf Seiten des Konsums wie der Erwerbsarbeit; es findet eine neue Konsumentenrevolution statt, die weniger auf Massenkonsum von Standardgtern setzt als auf symbolische Gter, Erlebnisse, Dienste und mediale Formate in groer Differenziertheit. DIe Entindustrialisierung frdert die Expansion der Wissenskonomie fr Hochqualifizierte, eine hochgradig subjektivierte Arbeit im permanenten Wettbewerb um Hchstleistungen: Eine liberalisierte konomie, die nicht nach dem Durchschnitt strebt, sondern nach Exzellenz; die nicht nur Einkommen, sondern auch persnliche Befriedigung verspricht. Die dritte Gre, der laut Reckwitz den Wandel von der Gesellschaft der Gleichen zur Gesellschaft der Singularitten vorantreibt, ist die digitale Revolution. Die Technik der Industriegesellschaft wirkte standardisierend, die digitale Technologie der Sptmoderne wirkt in mehreren Hinsichten singularisierend. Im Internet findet ein Wettbewerb um Aufmerksamkeit statt, in dem nur Differenz heraussticht, die digitale Welt ist auf das Individuum zugeschnitten. An die Stelle der allgemeinen medialen ffentlichkeit treten partikulare Communities, die sich jeweils selbst besttigen. Das verstrkt die Herausforderung des liberalen politischen Systems, auch durch Populismus. Seine Attraktivitt gewinnt dieser aus der neuen Spaltungslinie, die zwischen kosmopolitisch orientierten "e;Liberalisierungsgewinnern"e; und traditionalistisch eingestellten "e;Liberalisierungsverlierern"e; verluft. Insbesondere diejenigen, die sich als Verlierer der oben beschriebenen Vernderungen sehen und einen konomischen und/oder einen kulturellen Verlust frchten, werden von ihm angesprochen. Gesellschaftsdiagnosen haben Konjunktur und bestimmen den gesellschaftlichen und politischen Diskurs teilweise mageblich mit. Diese Ausgabe des Journal benennt gngige Standortbestimmungen, bringt sie mit Phnomenen wie Digitalisierung, konomie und Populismus in Verbindung und versucht, diese fr die politische Bildung urbar zu machen.
- Autorenportrait
- Martin Altmeyer, Dr. rer. med. habil., Dipl. Psych., ist Privatdozent für psychoanalytische Psychologie. Er war lange als klinischer Psychologe in der Reformpsychiatrie und als Leiter der Personal- und Organisationsentwicklung bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) tätig.Pamela Brandt ist Redakteurin in der Online-Redaktion der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) und Projektverantwortliche für den Wahl-O-Mat. Neben multimedialen und inhaltlichen Angeboten für die Webseite www.bpb.de ist sie seit 2004 Projektleiterin des Wahl-O-Mat. Sie studierte Geschichte, Französisch, Pädagogik und Journalismus in Hamburg, Paris und Bordeaux und arbeitete anschließend für verschiedene Fernsehsender und Zeitungen.Prof. Dr. Klaus Dörre ist seit 2005 Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, einer der Direktoren des DFG-Kollegs Postwachstumsgesellschaften und Mitherausgeber des Berliner Journal für Soziologie und des Global Dialogue. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Kapitalismusmustheorie, Prekarisierung von Arbeit und Beschäftigung, Arbeitsbeziehungen, soziale Folgen der Digitalisierung sowie Rechtspopulismus.Prof. Dr. Dirk Jörke ist seit 2014 Professor für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Technischen Universität Darmstadt, von 2010 bis 2014 war er Heisenbergstipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Seine Forschungsgebiete sind Demokratietheorie und Populismus, insbesondere US-amerikanischer Populismus. Dr. Daniela Kallinichstudierte Diplom-Sozialwissenschaften in Göttingen und Caen und ist Mitarbeiterin der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Nach dem Studium hat sie am Göttinger Institut für Demokratieforschung zu Parteien, Politik und Gesellschaft in Frankreich und Deutschland geforscht und sich theoretisch und praktisch mit dem Thema Demokratiebildung mit Kindern beschäftigt.Joanna Mechnich (M.A.) studierte Friedensforschung und Internationale Politik an der Eberhard Karls Universität Tübingen und ist Mitarbeiterin der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Zuvor war sie u.a. freiberuflich für das Netzwerk für Demokratie und Courage und die Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg tätig. Prof. Dr. Ursula Münchist Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing sowie Professorin für Innenpolitik und Vergleichende Regierungslehre an der Universität der Bundeswehr München.Prof. Dr. Andreas Reckwitz studierte Soziologie, Politikwissenschaft und Philosophie. Er ist Professor für Kultursoziologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder und Träger des Leibniz-Preises.Dr. Ernst-Dieter RossmannMdB, Dipl. Psychologe, Doktor der Sportwissenschaft, ist Vorsitzender des Deutschen Volkshochschul-Verbandes.Prof. Dr. Roland Roth arbeitete zuletzt als Professor für Politikwissenschaft am Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen der Hochschule Magdeburg-Stendal (1993-2014). Sein wissenschaftliches und politisches Interesse gilt den Themenfeldern Demokratie, soziale Bewegungen, Zivilgesellschaft, Bürger- und Menschenrechte. Dr. Veith Selk ist seit 2014 Post-Doc am Institut für Politikwissenschaft der Technischen Universität Darmstadt. Im Wintersemester 2017/18 vertrat er die Professur für Politische Theorie und Ideengeschichte im Fach Politik der Universität Trier. Seine Forschungsgebiete umfassen Politische Theorie, Demokratietheorie, Populismus, Pragmatismus und Ideengeschichte. Dr. Alexander Wohnigist akademischer Mitarbeiter an der Heidelberg School of Education (Universität und Pädagogische Hochschule Heidelberg). Seit Frühjahr 2017 ist er zudem Teil der erweiterten Journal-Redaktion.