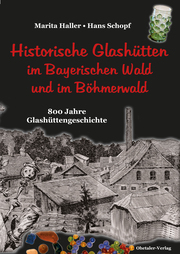Detailansicht
Historische Glashütten im Bayerischen Wald und im Böhmerwald
800 Jahre Glashüttengeschichte
ISBN/EAN: 9783955110840
Umbreit-Nr.: 5090192
Sprache:
Deutsch
Umfang: 210 S., 630 Illustr., Historische Bilder und Landk
Format in cm: 1.8 x 30.5 x 21.5
Einband:
gebundenes Buch
Erschienen am 25.05.2018
- Zusatztext
- Historische Glashütten im Bayerischen Wald und im Böhmerwald 800 Jahre Glashüttengeschichte Glashütten können im bayerischen und im böhmischen Grenzraum über 800 Jahre zurückverfolgt werden. Ende des 14. Jahrhunderts arbeiteten schon 49 kleine und aus Holz gebaute Glashütten auf bayerischem und 90 Glashütten auf böhmischem Gebiet. Sie fertigten vor allem "Patterl" (Rosenkranzperlen) für die Klöster, Knöpfe, Butzen, Gefäße für Alchimisten, einfaches Gebrauchsglas und Fensterglas nach dem Zylinder-Blasverfahren. Dieses geschichtliche Werk erinnert an 230 zum Teil schon längst vergessene Glashütten und an namhafte Glashüttenherrn und Glasmacher. Ausführliches Kartenmaterial und Beschreibungen vermitteln den Standort von einstigen Glashütten, deren Reste manchmal noch in den Wäldern zu finden sind. Dieses Werk ist zudem ein Fundus an 630 historischen Fotos, Zeichnungen und Gemälden dieser einst so stolzen Traditionsindustrie. Für Genealogen kann es beim Auffinden ihrer Familienmitglieder helfen, die einst Glasmacher waren. Dieser fantastische Bildband ist aber auch eine Hommage an die Traditionsglashütten, die bis heute den zunehmend schwierigen Zeiten in der Glasindustrie trotzen und noch immer Menschen Lohn und Brot geben. Er basiert auf Forschungsergebnissen von namhaften Historikern und Heimatforschern und ist somit für jeden geschichtlich Interessierten ein unverzichtbares Nachschlagewerk zum Thema bayerische und böhmische Glashütten. Es ist das erste Mal, dass die grenzüberschreitende Glashüttengeschichte in einem Buch dargestellt wird.
- Kurztext
- Vorwort von Marita Haller Glashütten im bayerisch-böhmischen Grenzraum können über 800 Jahre zurückverfolgt werden. Es wird vermutet, dass die ersten Glasmacher aus Bayern in den Böhmerwald kamen. Im 13. Jahrhundert sind beidseits der Grenze bereits Glashütten belegt. Ortsnamen verweisen auf diese frühe Glashüttentätigkeit. Ende des 14. Jahrhunderts sollen schon 49 kleine Glashütten auf bayerischem und 90 Glashütten auf böhmischem Gebiet gearbeitet haben. Sie fertigten überwiegend "Patterl", also Rosenkranzperlen, Knöpfe, "Butzen" für Fensterscheiben und Scheiben nach dem Zylinderverfahren für Klöster und Kirchen, einfache Hohlkörper und auch Gefäße für Alchimisten. Landesgrenzen wurden seinerzeit kaum beachtet. Die Glasmacher zogen von einer Glashütte zur anderen. Vor dem Hussitenkrieg (1419-1434) war die bayerisch-böhmische Grenzregion bereits ein Zentrum der Glasindustrie. Die frühen Glashütten waren aus Holz gebaut und konnten so, wenn der Wald rund um die Glashütten für Wohnhütten, Pottasche, Befeuerung der Glasöfen und Schmelzhäfen abgeholzt war, immer wieder an anderer Stelle und Jahre später wieder an gleicher Stelle, teils unter einem anderen Namen, neu in Betrieb genommen werden. Der Volksmund gab den Hütten zudem oft zusätzliche Namen. Waren die Glashütten zum Beispiel nach dem Besitzer genannt, erhielten sie vom Volksmund noch den Namen des jeweils aktuellen Pächters. So konnte eine Glashütte im Laufe der Zeit mehrere unterschiedliche Namen haben. Wurde eine Glashütte aufgelassen, erhielt sie oft die Bezeichnung "Althütte" oder "Altglashütte" und die an anderer Stelle neu eröffnete Glashütte die Bezeichnung "Neuhütte" oder "Neuglashütte". In fast jeder Region gab es diese gleichen Namensbezeichnungen. Deshalb war es bei der Recherchearbeit sehr schwierig, nicht den Überblick zu verlieren. Ende des 15. Jahrhunderts war Gebrauchsglas auch in ärmere Haushalte eingezogen. Auch so genannte Scherzgläser waren in Mode gekommen. Ab dem 19. Jh. kam das so genannte "Bauernsilber" in Gebrauch. Glasobjekte wurden zwischen zwei Glasmänteln innen mit Quecksilber verspiegelt und so hatten die armen Leute auch "Silber" auf dem Tisch. Heute sind diese Glasobjekte bei Sammlern sehr beliebt, insbesondere wenn sie zusätzlich bemalt wurden. Im 16./17. Jh. fand eine weitere, überaus rege Glashütten-Bautätigkeit statt. Die Hütten wurden von den Glasherren bevorzugt in der Nähe von Handelswegen angelegt, sie wurden aber auch oft an abgelegenen, steilen Waldhängen in der Nähe eines Baches errichtet. Dort fraßen sie sich förmlich in den Wald und machten selbst ein schlecht zugängliches Gelände nutzbar. Man kann sich vorstellen, dass es nicht einfach war, auf den kaum befahrbaren steilen und steinigen Wegen das für die Glashütte notwendige Material und auch die fertigen Glaswaren zu transportieren. Die Wegebefestigungen, bei welchen Stein an Stein stößt, sind zum Teil bis heute erhalten. Reiche, venezianische Techniken hatten im 17/18. Jahrhundert Einzug in die Glashütten gehalten. Bekannte Glasmeister-Namen tauchten auf, wie Eisner, Hafenbrädl, Poschinger, Bock, Gerl, Schürer, Hirsch, Abele, Hilz, Schrenk, Frisch, Müller, Adler, Gattermayer und andere. Sie ließen die Glasbranche florieren. Im 18. und 19. Jahrhundert waren die Glasbetriebe und Veredelungsbetriebe immer größer geworden. Immer mehr Menschen fanden Brot und Lohn durch Glas. Produziert wurden u.a. Rosenkranzperlen, Knöpfe, Apothekerglas, Butzen für Scheiben, Tafel- und Spiegelglas sowie Hohlglas/Tischglas, Flaschen und Brillenglas. Mit der weiteren Entwicklung von Tafelglas wuchsen ab dem 18. Jahrhundert auch Hinterglasmaler förmlich aus dem Boden, die viele Rohglasscheiben benötigten. Die Hüttenherren mussten ihre Preise vorausschauend kalkulieren. Wenn die Glashändler mit ihren Fuhrwerken zu den Glashütten kamen, mussten sie dort oft auf ihre Bestellung warten. Das konnte bis zu 2 Monate dauern, bis die georderten Gläser fertig waren. Während dieser Zeit wohnten sie b