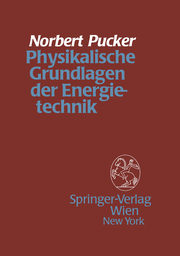Detailansicht
Physikalische Grundlagen der Energietechnik
ISBN/EAN: 9783211819487
Umbreit-Nr.: 5743493
Sprache:
Deutsch
Umfang: xi, 356 S., 182 s/w Illustr., 356 S. 182 Abb.
Format in cm:
Einband:
kartoniertes Buch
Erschienen am 24.10.1986
Auflage: 1/1986
- Zusatztext
- Energie ist wahrend des letzten Jahrzehnts wie nie vorher zu einer Frage der Politik geworden. Gleichzeitig ist Energie einer der zentralen Begriffe der Physik. Das ist auch heute noch besonders eindrucksvoll bei Max Planck in seinem Buch "Das Prinzip der Erhaltung der Energie" formuliert, das vor mehr als 80 Jahren erschienen ist. Ich habe erfahren, daB es nicht immer leicht ist, die Brucke zwischen den grundsatz lichen Aspekten des Energiebegriffs und den praktischen Gesichtspunkten der Bereitstellung und Nutzung von Energie zu finden. Diese Erfahrung hat mich zur Arbeit an dem vor liegenden Buch verleitet. Eine mehrsemestrige Vorlesungs tatigkeit zu Teilbereichen des Themas und gelegentliche Teil nahme an offentlichen Diskussionen zum Fragenkreis Energie haben mich in meinen Bemuhungen dazu noch bestarkt. In diesem Buch werden die physikalischen Grundlagen, die bei der Bereit stellung und Umwandlung der verschiedenen Energieformen - be sonders Warme, Wind-, Sonnen- und Kernenergie - eine Rolle spielen, fur einen breiteren Interessentenkreis ubersichtlich dargestellt. Ich denke hiebei an Dozenten, Techniker, an Physiker, die nicht direkt in den der Energienutzung ver schriebenen Teilbereichen tatig sind, und an Physikstudenten. Wie immer bleiben die Schwerpunkte einer solchen Darstellung subjektiv und von den unmittelbaren Erfahrungen des Autors gepragt. Ich glaube gelernt zu haben, daB ein gutes Ver standnis der grundlegenden Zusammenhange eine notwendige Basis zur Beurteilung der anwendungsorientierten Seite des Energieproblems ist. Dementsprechend liegt auch der Schwer punkt der Darstellung bei der Physik der Energieformen. Die praktische Verwirklichung in Form bestehender oder geplanter Anlagen wird nur kurz und eher beispielhaft beschrieben.
- Autorenportrait
- InhaltsangabeI. Vom Wesen der Energie.- I.1. Auf dem Weg zu einem immer tieferen Verständnis des Energiebegriffes.- I.1.1. Die mechanische Energie.- I.1.2. Die Wärmekraftmaschinen und das Verständnis der Wärme.- I.1.3. Das mechanische Wärmeäquivalent.- I.1.4. Der Satz von der Erhaltung der Energie.- I.1.5. Die Äquivalenz von Masse und Energie.- I.1.6. Die Wertigkeit der Energie: Der zweite Hauptsatz der Wärmelehre und die Entropie.- I.2. Mechanische Arbeit; die verschiedenen Energieformen; Wärmeströmung als Form des Energieaustausches.- I.2.1. Mechanische Arbeit.- I.2.2. Beispiele für die Übertragung mechanischer Energie.- I.2.3. Energieform Wärme; weitere Energieformen.- II. Thermodynamische Grundlagen der Energietechnik.- II.1. Erster Hauptsatz der Thermodynamik für geschlossene und offene Systeme.- II.2. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik; Reversibilität und Irreversibilität; Entropie.- II.2.1. Der zweite Hauptsatz.- II.2.2. Reversibilität und Irreversibilität.- II.2.3. Die Entropie.- II.2.4. Anwendungen des zweiten Hauptsatzes; Erzeugung von Entropie.- II.2.4.1. Temperaturausgleich.- II.2.4.2. Gay-Lussacscher Drosselversuch.- II.2.4.3. Der Carnotsche Wirkungsgrad ?c als Maximalgröße.- II.3. Die Exergie als Mittel zur Bewertung thermodynamischer Prozesse.- II.3.1. Energetische und thermodynamische Bewertung von Energieumsetzungen.- II.3.2. Exergie und verfügbare Arbeit.- II.3.3. Beispiele zur Bestimmung der Exergie; Folgerungen.- II.3.3.1. Exergie eines elektrisch geheizten Durchlauferhitzers.- II.3.3.2. Raumheizung durch elektrische Widerstandsheizung oder eine Carnotsche Wärmepumpe.- II. 3.3.3. Dampfkraftwerk, Verbrennungsprozeß, "energy cascading".- II. 4. Wärmepumpe, Wärmetransformator.- II.4.1. Kompressionswärmepumpe.- II.4.2. Absorptionswärmepumpe, Wärmetransformator.- II.4.3. Einsatz neuer Mehrstoff-Systeme.- II.4.4. Wärmequellen.- II.5. Versuche zur Bereitstellung mechanischer Energie mit Hilfe von Niedertemperaturwärme; Energieerntefaktor.- II.5.1. Bereitstellung von mechanischer Energie mit Hilfe von Niedertemperaturwärme.- II.5.1.1. Stirling-Motor für sehr kleine Temperaturdifferenzen.- II.5.1.2. Der Curie-Motor.- II.5.2. Der Energieerntefaktor.- II.6. Grundlagen der Wärmeleitung; bauphysikalische Anwendungen.- III. Grundlagen zur Nutzung der Windenergie.- III.1. Primärenergieform Wind.- III.1.1. Allgemeine Grundlagen.- III.1.2. Strömungsmechanische Grundlagen.- III.1.2.1. Beschreibung von Orts- und Zeitverhalten eines Fluids.- III.1.2.2. Stromlinie, Stromröhre, Stromfaden.- III.1.2.3. Kontinuitätsgleichung, Eulersche und Bernoullische Gleichung.- III.2. Energieumsetzungen an Windrädern.- III.2.1. Einfache Theorie des Windrades.- III.2.2. Analyse der Vorgänge am Windradflügel; Schnell-und Langsamläufer.- III.3. Windenergieanlagen.- IV. Strahlungsenergie der Sonne.- IV.1. Verfügbare Strahlungsenergie.- IV.1.1. Die Solarkonstante; astronomische Berechnungsgrundlagen.- IV.1.2. Einfluß der Atmosphäre auf die Sonneneinstrahlung.- IV.1.2.1. Die relative optische Dicke der Atmosphäre.- IV.1.2.2. Streu- und Absorptionsprozesse in der Atmosphäre.- IV.2. Festkörperphysikalische Grundlagen für thermische und photovoltaische Nutzung der Strahlungsenergie der Sonne.- IV.2.1. Beschreibung der Wechselwirkung von Strahlungsfeld und Materie mit Hilfe der frequenzabhängigen Dielektrizitätskonstante.- IV.2.2. Die Quantennatur des Festkörpers.- IV.2.3. Optische Absorptionsprozesse in Festkörpern.- IV.2.3.1. Übersicht.- IV.2.3.2. Joulesche Wärme, Absorption durch freie Ladungsträger.- IV.2.3.3. Interbandabsorption. Direkte und indirekte Übergänge.- IV.2.3.4. Gitterabsorption.- IV.2.3.5. Emission von Wärmestrahlung.- IV.2.3.6. Optische Selektivität.- IV.3. Photothermische Energieumwandlung.- IV.3.1. Flachkollektoren.- IV.3.2. Konzentrierende Kollektoren.- IV.3.2.1. Fokussierende Systeme.- IV.3.2.2. Elemente parabolischer zylindrischer Konzentratoren.- IV.3.2.3. Nichtabbildende konzentrierende Systeme.- IV.3.2.4. Nachführung von Kollektoren.- I