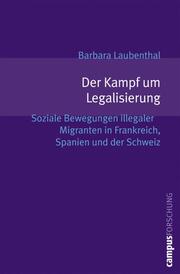Detailansicht
Der Kampf um Legalisierung
Soziale Bewegungen illegaler Migranten in Frankreich, Spanien und der. Schweiz, Campus Forschung 920
ISBN/EAN: 9783593383606
Umbreit-Nr.: 1322742
Sprache:
Deutsch
Umfang: 253 S.
Format in cm: 2 x 21.4 x 14.3
Einband:
Paperback
Erschienen am 21.05.2007
Auflage: 1/2007
- Kurztext
- Europa fühlt sich von illegaler Einwanderung bedroht. Die Seite der Migranten wird dabei kaum gesehen. In Frankreich, Spanien und der Schweiz allerdings initiierten Einwanderer soziale Bewegungen und protestierten erfolgreich gegen ihren illegalen Status. Barbara Laubenthal zeigt die Faktoren, die Entstehung und Erfolg der sozialen Bewegungen ermöglichen: Spezifika der Einwanderungspolitik, zivilgesellschaftliche Veränderungen sowie die jeweiligen historischen Bindungen zwischen Herkunfts- und Aufnahmeländern.
- Autorenportrait
- InhaltsangabeInhalt Dank Vorwort von Claus Leggewie 1. Einleitung 2. Illegalität in Westeuropa: Entstehung, Charakteristika und staatlicher Umgang mit illegaler Migration 3. Entwicklung eines Modells zur Untersuchung der Entstehungsbedingungen der Pro-Regularisierungsbewegungen 3.1 Soziale Bewegungen und politische Systeme 3.2 Der POSAnsatz ein gescheitertes Modell zur Bewegungsentstehung 3.3 Eine Alternative zum POS-Ansatz: Die Eingrenzung von "politischer Kontext" auf "Unterstützer" und "Politikfeld" 3.4 Die Bedeutung von Diskursen 3.5 Medien als Akteure 3.6 Zusammenfassung: Notwendige Elemente einer Untersuchung der Pro-Regularisierungsbewegungen 4. Operationalisierung und methodisches Vorgehen 4.1 Experteninterviews 4.2 Medienanalyse 4.3 Dokumentenanalyse 5. Frankreich 5.1 Politisches System und soziale Bewegungen 5.2 Die französische Pro-Regularisierungsbewegung 1996-1998 5.2.1 Migrationspolitik und -gesetze und Illegalität 5.2.1.1 Die Einwanderungsgeschichte Frankreichs 5.2.1.2 Die französische Einwanderungspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg: Arbeitskräfterekrutierung und Steuerungsdefizit 5.2.1.3 Die Existenz kollektiver und permanenter Regularisierungsmöglichkeiten 5.2.1.4 Verschärfungen der Gesetzgebung und die Abschaffung von Regularisierungswegen 5.2.2 Unterstützer 5.2.2.1 Organisationen der französischen Antirassismus-Bewegung 5.2.2.2 "Etre sans-papiers, l'exclusion des exclusions" - Neue zivilgesellschaftliche Akteure und ihre Unterstützung der illegalen Migranten 5.2.2.3 Weitere Unterstützer der illegalen Migranten: "Die Alten" 5.2.2.4 Unterstützung durch Parti Socialiste und Parti Communiste Français: Das Thema illegale Einwanderung als Profilierungsfeld 5.2.2.5 Herkunftsstaaten als Unterstützer 5.2.3 Das Framing der französischen Bewegung 5.2.3.1 Disruptive Aktionen und "französische Werte" 5.2.3.2 Der Zweite Weltkrieg und der Kolonialismus als Legitimationsfelder für die Bewegung 5.2.4 Die Rolle der Medien 5.2.4.1 Der Kampf um die Begriffe: Von "Clandestins" zu "sans-papiers" 5.2.4.2 "Frauen und Kinder zuerst" - Personalisierte Darstellungsformen 5.2.4.3 Die Wirkung von Nachrichtenfaktoren: Tod und Gewalt als "Topthemen" 5.2.5 Reaktionen der Regierung und Folgen der Bewegung 5.2.6 Zusammenfassung 6. Spanien 6.1 Politisches System und soziale Bewegungen 6.2 Die spanische Pro-Regularisierungsbewegung 2001 6.2.1 Migrationspolitik und -gesetze und Illegalität 6.2.1.1 Zwischen Restriktion und Permissivität - ein hybrides Migrationsregime 6.2.1.2 Regularisierungsprozesse und Entstehung der Proteste 6.2.1.3 Gesetzesänderungen im Jahr 2000 6.2.2 Unterstützer 6.2.2.1 Zivilgesellschaft und Einwanderung 6.2.2.2 Die Präsenz neuer Akteure in der Pro-Regularisierungsbewegung 6.2.2.3 Herkunftsstaaten als Unterstützer 6.2.2.4 Der murcianische Arbeitsmarkt und die Interessen der Arbeitgeber 6.2.3 Das Framing der spanischen Bewegung 6.2.4 Die Rolle der Medien 6.2.4.1 Die Darstellung von Einwanderung in den spanischen Printmedien 6.2.4.2 "Der Tod braucht keine Papiere" - Die Rezeption des Unfalls von Lorca und der Aktionen der Pro-Regularisierungsbewegung 6.2.4.3 Reaktionen der Öffentlichkeit 6.2.5 Reaktionen der Regierung und Folgen der Bewegung 6.2.6 Zusammenfassung 7. Schweiz 7.1 Politisches System und soziale Bewegungen 7.2 Die Schweizer Pro-Regularisierungsbewegung 2001 7.2.1 Migrationsspolitik und -gesetze und Illegalität 7.2.1.1 Zwischen ökonomischen Bedürfnissen und Angst vor "Überfremdung" - Entstehung und Grundzüge der Schweizer Ausländerpolitik 7.2.1.2 Prekärer Aufenthaltsstatus als strukturelles Merkmal des Schweizer Migrationsregimes 7.2.1.3 Die Einführung des Drei-Kreise-Modells und der Rekrutierungsstopp für Arbeitnehmer aus dem ehemaligen Jugoslawien 7.2.1.4 Die indirekte Akzeptanz von illegalem Aufenthalt 7.2.1.5 Kollekt
- Schlagzeile
- Campus Forschung
- Leseprobe
- Vorwort von Claus Leggewie: Illegale eine unmögliche soziale Bewegung? Ein 1982 in Bremen geborener Deutsch-Türke sorgte im Winter 2007 beinahe für den Sturz des deutschen Bundesaußenministers. Murad Kurnaz hatte nach seiner Freilassung behauptet, nicht nur US-amerikanische, sondern auch deutsche Stellen hätten für die langjährige, in vieler Hinsicht unrechtmäßige Inhaftierung des Unschuldigen auf dem US-Stützpunkt Guantánamo gesorgt und, noch wichtiger, die rot-grüne Bundesregierung habe wissentlich und willentlich Chancen verstreichen lassen, ihn früher aus dem völkerechtswidrigen Gefangenenlager freizubekommen. Der komplizierte Fall soll hier nicht in seinen Details gewürdigt werden, nur eine Facette spielt im Blick auf die vorliegende Arbeit von Barbara Laubenthal eine Rolle: Der Innensenator von Bremen (wo Kurnaz gemeldet war und vor seiner Abreise nach Pakistan gelebt hatte) wollte 2004 bewirken, dass Kurnaz nach einer eventuellen Freilassung nicht wieder nach Deutschland einreisen dürfe. Der Grund: Seine unbefristete Aufenthaltserlaubnis sei wegen eines mehr als sechsmonatigen Auslandsaufenthalts erloschen! Kurnaz habe ja versäumt, die vorgeschriebene Verlängerung der Wiedereinreisefrist zu beantragen. Das kommentierte ein mit dem Vorgang befasster Beamter mit dem Vermerk "ungewöhnlich!", ein anderer notierte dazu "na und?" Es gibt noch Richter in Deutschland: Das Bremer Verwaltungsgericht entschied dazu im November 2005, die Aufenthaltserlaubnis sei weiterhin gültig, da Kurnaz ja keine Gelegenheit gehabt hätte, sie zu verlängern. Die Episode zeigt, wie Staaten Tatbestände illegalen Aufenthalts und nicht ordnungsgemäß registrierter Einwanderung überhaupt erst schaffen. Man wollte Kurnaz loswerden und die Tatsache ausnutzen, dass auch die Türken ihren Staatsbürger nicht haben wollten. Hier sieht man, wie leicht auch Demokratien bereit sind, angesichts einer ohne Zweifel bestehenden, im Fall Kurnaz aber ominösen Terrorgefahr Grundrechte ihrer Bürgerinnen und Bürger preiszugeben; sie zeigt ferner, was mit Staatenlosen passieren kann, denen weder ein Land zu Hilfe kommt, dessen Staatsbürger sie sind (oder waren), noch ein Land, wo eine ordentliche Aufenthaltsgenehmigung und - notabene - der langjährige Lebensmittelpunkt bestand. Nichtregistrierte/dokumentierte Migration ist ein fluktuierendes Phänomen, das, wie das extreme Beispiel Kurnaz belegt, häufig erst durch restriktive Maßnahmen von Aufnahmestaaten entsteht. "Illegale" leben wie unsichtbar in unsicheren und ungeschützten Rechts und Erwerbsverhältnissen, ständig unter dem Damoklesschwert nationaler und supranationaler Kontroll und Repressionspolitiken und unter dem Diktat einer per se widersprüchlichen Haltung, die in den OECDStaaten gegen alle Bekenntnisse eine permanente Nachfrage nach nichtregularisierter Einwanderung erzeugt. Regularisierungspolitik ist bisher nur vereinzelt untersucht worden; besondere Beachtung schenkt diese Studie den ProRegularisierungsBewegungen, die in dieser politischlegalen Lücke agieren. Barbara Laubenthal widmet sich dem erst in der jüngeren Migrationsforschung intensiver bearbeiteten Thema der "Illegalen" in einer bisher ebenfalls fehlenden Vergleichsperspektive. Spektakuläre Aktionen der "sanspapiers" in diversen Ländern haben die Aufmerksamkeit auf diese Gruppierung gelenkt und dem Protest eine europäische Dimension verliehen. Als besonders erklärungsbedürftig stellt die Verfasserin heraus, dass illegale Migranten neuerdings als politische Akteure auftreten und das in einem Bereich, der, anders als frühere soziale Bewegungen in weicheren Politikbereichen, geeignet sind, ein Kernelement nationalstaatlicher Souveränität in Frage zu stellen. Stellt man sich die berühmte Frage "Why Men Rebel" (Ted Gurr 1970) und nimmt die geläufigen Antworten der Bewegungsforschung, dann ist eine soziale ProtestBewegung nicht registrierter Einwanderer eigentlich "unmöglich". Die erstaunliche Mobilisierung derart ressourcenschwacher Akteure in einem derart sensiblen ThemenBereich verdient also auch wissenschaftliche Aufmerksamkeit, nachdem insbesondere die Massenproteste legal und illegal in den USA lebender Einwanderer im Frühjahr 2006 für weltweite publizistische Resonanz gesorgt haben. Laubenthals Studie bringt nicht nur neue Erkenntnisse für die interdisziplinäre Migrationsforschung, sondern auch für die Erforschung neuer sozialer Bewegungen, und hier behandelt sie vor allem den wichtigen Aspekt der Medialisierung, der auch solchen Anliegen Nachdruck verleiht, die nicht mit Massenprotesten aufwarten können. Es ist zu hoffen, dass dieser auch disziplinären Grenzüberschreitung weitere komparative Fallstudien folgen und "Illegalen" mehr gesellschaftliche Beachtung und politische Unterstützung als bisher zuteil wird.