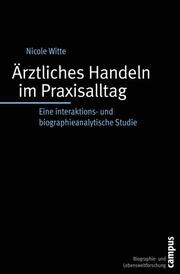Detailansicht
Ärztliches Handeln im Praxisalltag
Eine interaktions- und biographieanalytische Studie, Biographie- und Lebensweltforschung 8
ISBN/EAN: 9783593393131
Umbreit-Nr.: 1154659
Sprache:
Deutsch
Umfang: 475 S., 8 Fotos
Format in cm: 3.3 x 21.5 x 14
Einband:
Paperback
Erschienen am 08.11.2010
Auflage: 1/2010
- Zusatztext
- InhaltsangabeInhalt 1. Einleitung 1.1 Vorbemerkung 1.2 Die Forschung 1.2.1 Das Forschungsinteresse 1.2.2 Der Forschungsverlauf 1.3 Aufbau der Arbeit 2. Stand der Forschung 2.1 Vorbemerkung 2.2 Die ambulante ärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland 2.3 Die ArztPatientInteraktion als Forschungsgegenstand 2.3.1 (Allgemein-)medizinische Forschung zur Arzt-Patient-Interaktion 2.3.2 Weitere Forschungsaktivitäten zur Arzt-Patient-Interaktion 2.4 Die Biographie des Arztes als Forschungsgegenstand 2.4.1 (Allgemein-)medizinische Forschung zur ärztlichen Biographie 2.4.2 Weitere Forschungen zur (ärztlichen) Biographie 2.5 Zur Zusammenführung beider Fallebenen 3. Methodisches Vorgehen 3.1 Vorbemerkung 3.2 Methodologische Anmerkungen 3.3 Forschungsmethoden 3.3.1 Feldzugang und Sampling 3.3.2 Biographieanalytische Perspektive 3.3.3 Interaktionsanalytische Perspektive 3.4 Zur möglichen Kombination der Ergebnisse 4. Empirische Untersuchungen 4.1 Überblick 4.2 Eike Fink: Macht als Schutz 4.2.1 In der Gegenwart - Aus der Gegenwart heraus 4.2.2 Die Fallgeschichte Eike Fink 4.2.3 Sequenzielle Videoanalyse im Fall Eike Fink 4.3 Dr. Andrea Sperber: Voran, nie zurück 4.3.1 Vorbemerkung 4.3.2 Die Fallgeschichte Dr. Andrea Sperber 4.3.3 Sequenzielle Videoanalyse im Fall Dr. Andrea Sperber 4.4 Dr. Bernd Zeisig: Schuld und Sühne 4.4.1 Vorbemerkung 4.4.2 Die Fallgeschichte Dr. Bernd Zeisig 4.4.3 Sequenzielle Videoanalyse im Fall Dr. Bernd Zeisig 5. Empirische Ergebnisse 5.1 Überblick 5.2 Die Fallebene Biographie 5.2.1 Funktion der Berufswahl 5.2.2 Etablierung von professionellen Handlungsmustern 5.2.3 Biographische Strukturierungen 5.2.4 Sozialisation als Arzt, ärztliches Selbstbild, WIR Ärzte 5.3 Die Fallebene Interaktion 5.3.1 Bedeutung der Kontextfaktoren 5.3.2 Strukturierte und strukturierende Handlungsmuster 5.3.3 Wenige Variationen des Handelns 5.3.4 Krisen in der Interaktion 5.3.5 Reproduktion oder Transformation von Handlungs mustern? 5.3.6 Interaktionsbestandteile und ihre Wirkungen 5.4 Verknüpfung der Fallebenen 6. Fazit und Ausblick: Was bleibt und was folgt? Abbildungsverzeichnis Literatur Anhang: Verwendete Transkriptionszeichen
- Kurztext
- Nicole Witte untersucht mittels Videoanalysen von Konsultationen und lebensgeschichtlichen Interviews, wie Ärztinnen und Ärzte mit ihren Patienten interagieren und wie sich diese Interaktionsmuster im bisherigen Lebensverlauf herausgebildet haben. Die Studie beschränkt sich damit nicht auf die Betrachtung einer professionellen Rolle, sondern lässt den Arzt oder die Ärztin als ganzen Menschen im Sprechzimmer sichtbar werden.
- Schlagzeile
- Biographie- und Lebensweltforschung
- Leseprobe
- Schon lange vor Beginn meiner Forschungsbemühungen in den Themenbereichen >ärztliches Handeln< oder >Arzt-Patient-Interaktion< und damit vor dem Beginn meiner wissenschaftlichen Arbeit insgesamt hat mich die Frage beschäftigt, warum es manchen Ärztinnen und Ärzten gelang, mich in einer Weise anzusprechen, die bei mir als Patientin den Eindruck von Verständnis und Empathie (und damit häufig auch medizinisch angemessener Behandlung) hinterließ. Konsultationen bei anderen Mediziner/-innen verliefen demgegenüber ganz anders, irritierten mich teilweise, machten mich unzufrieden oder manchmal sogar wütend. In Gesprächen im Familien- oder Bekanntenkreis wurde dann regelmäßig deutlich, dass diese von mir wahrgenommene Varianz im Handeln verschiedener Ärztinnen und Ärzte keineswegs nur meine individuelle Erfahrung war. Darüber hinaus wurden mir von meinen Gesprächspartnern stets Erklärungsmodelle dafür präsentiert, warum der eine Arzt sympathisch und zugewandt agiert, der andere hingegen sachlich und wenig empathisch und der dritte gar elementare Regeln der Höflichkeit außer Acht lässt und beispielsweise die Begrüßung des Patienten zu Beginn einer Konsultation offenbar für einen überflüssigen Luxus hält. "Der ist eben so"; "Der ist nett" oder "Die ist immer sehr ernst" waren zu hörende Erklärungen der Menschen, mit denen ich im Alltag über ihre Erfahrungen mit Ärztinnen und Ärzten gesprochen habe. Diese alltagsweltlichen Sinndeutungen korrespondieren mit psychologischen Annahmen, dass Konzepte wie Selbst, Einstellungen, Fähigkeiten, Motive, Gefühle, aber auch beispielsweise Geschlecht psychische oder gar physische Merkmale eines Individuums sind und in der wissenschaftlichen >Übersetzung< damit unabhängige Variablen darstellen, die selbstverständlich im Vorfeld der Untersuchung genauestens festzulegen sind. Eine Vorstellung dieser Konzepte als "diskursiv hergestellt" und damit eher als "Attribute von Konversationen und nicht als mentale Einheit[en]" (Harré 1992: 526) war mir zu Anfang meiner Forschung noch fremd. Erste mehr alltagsweltliche Deutungen vor diesem Hintergrund und die genannte methodische Ausbildung führten mich zu einem zunächst noch wenig elaborierten Erklärungsmodell für meine Fragestellung, welches >Talent< (der Ärztinnen und Ärzte) im Umgang mit den Patientinnen und Patienten als wichtigste (unabhängige) Variable für Patientenzufriedenheit oder eine gelingende Interaktion enthielt, jedoch noch der Operationalisierung bedurfte. Die Vorstellung von >Talent< als zentraler Variable wurde noch durch mein Literaturstudium über die standardisierte ärztliche Ausbildung in der Bundesrepublik Deutschland im Vorfeld der Untersuchung gestützt. Diese Ausbildung in Vorklinik und Klinik erschien offenbar nicht besonders geeignet, die unterschiedlichen persönlichen Fähigkeiten der einzelnen Studierenden durch entsprechende curriculare Maßnahmen zumindest annähernd einander anzugleichen bzw. auch zu verbessern, was ich zunächst sowohl auf die im medizinischen Studium eher randständige Gesprächs- oder Interaktionsausbildung als auch auf die Bedeutsamkeit der >Talent-Variable< zurückführte. Gäbe es sonst nicht weniger Varianz im ärztlichen Handeln und damit auch weniger Forschungsbedarf? Der Skizzierung meiner Ausgangsposition nachfolgend soll nun die Entwicklung meiner Forschung dargestellt werden, die mit der Öffnung der Forschungsfrage, der Änderung der theoretischen Perspektive auf den Forschungsgegenstand und der Änderung des methodischen Vorhabens einhergeht. Führte mich der Weg doch zu einer Untersuchung unter Anwendung einer methodischen Triangulation, angesiedelt im interpretativen Paradigma auf der Grundlage der bereits angedeuteten sozialkonstruktivistischen Handlungstheorie, und entfernte ich mich damit sehr weit von meinem oben ausgef