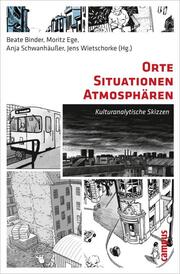Detailansicht
Orte - Situationen - Atmosphären
Kulturanalytische Skizzen
ISBN/EAN: 9783593392691
Umbreit-Nr.: 1460979
Sprache:
Deutsch
Umfang: 346 S.
Format in cm: 2.5 x 21.4 x 14
Einband:
Paperback
Erschienen am 04.10.2010
Auflage: 1/2010
- Zusatztext
- InhaltsangabeInhalt Orte Situationen Atmosphären: Eine Einleitung Beate Binder, Moritz Ege, Anja Schwanhäußer, Jens Wietschorke9 A Whole Way of Life - Oder: Wer wird Ethnograf? Der Lindenbaum Schattenwürfe eines Berliner Stadtgewächses BodoMichael Baumunk19 Die Lust des Forschers auf das Feld - und: Wer wird nicht Ethnograf? Ein Plädoyer Brigitta Schmidt-Lauber33 Die Grenzen der Kulturanalyse im Strafraum Von Theorie und Praxis im Fußballspiel Friedemann Schmoll45 Im Blick auf 'das Leben, wie es gelebt wird' Zur Logik von Umgangsstrategien mit Prekarität Elisabeth Katschnig-Fasch51 Urbane Atmosphären Urban atmospheres - An ethnography of railway stations Orvar Löfgren67 Marlene Dietrich auf dem Schiff von New York nach Southampton Joachim Schlör77 Mapping 'Queer Berlin' - Queering space!? Beate Binder87 Der Weg nach unten - Zur soziosymbolischen Homologie von Raum und Programm in der DDR-Gegenkultur Paul Kaiser103 Am Lutherplatz Vier Annäherungen an einen Stadtteil und seine Bewohner Robert Lorenz115 Strides on the Sound Side of Cities Helmuth Berking127 Geschmackslandschaften BroilerScapes - oder der Geschmack des MilchhähnchensPolygrafische Erkundungen spezifisch urbaner gustativer Wahrnehmungsstationen Ulf Matthiesen135 Über das unerhörte Verschwinden des Hundekots Tobias Timm145 Räume der Konsumtion in Berlin Erkundungen am Mierendorffplatz und im Rheingauviertel Jens Wietschorke151 Black Vienna - Reading the City upside down Anja Schwanhäußer169 Stern des Südens Warum der FC Bayern der typische Münchner Fußballverein ist Johannes Moser183 Geografische Imaginationen Die deutsche Entdeckung Indiens um 1800 - Bilder des Wissens in Friedrich Justin Bertuchs Bilderbuch für Kinder (1790-1830) Silvy Chakkalakal199 Balkangroove: Blas den Blues weg Walter Leimgruber und Nada Boskovska223 Stephansdom und Stadtmuschel - Zur visuellen Signatur Wiens Lutz Musner239 Räuber, Raufer, Dickschädel Zur kumulativen Textur des Innviertels Tobias Schweiger247 Wo ist Hannover? Barbara Lang261 Zone B ein Haiku1 mit Anmerkungen Alexa Färber267 Figuren und Figurationen Die Ränke der Utopie - Jugendliche Wildererphantasien im Salzburger Land des späten 18. Jahrhunderts Norbert Schindler275 'Why don't they act like who they really are?' Zur Peinlichkeit und Performativität von wannabes Moritz Ege289 Schwaben in Berlin - Metamorphosen einer kulturellen Figur und ihrer urbanen Topografien Thomas Bürk und Thomas Götz307 The MileEnd Hipster Montreal's Modern Day Folk Devil Geoff Stahl321 'Sind doch nicht alle Beckhams!' Autobiografische Skizzen zu Fußball, Fernsehen und Fans Lothar Mikos329 Autorinnen und Autoren339
- Kurztext
- DDR-Gegenkultur, Bahnhöfe oder der FC Bayern München - die hier versammelten Kulturanalysen handeln vom Alltagsleben. Die Autorinnen und Autoren untersuchen Orte, Situationen und Atmosphären und unternehmen ethnographische Erkundungen im städtischen Raum, die vom Balkanpop bis zu Schwaben in Berlin reichen. Entlang dieses kulturanalytischen Programms gibt der Band einen anregenden Einblick in aktuelle Forschungsgebiete, Methoden und Fragestellungen der Europäischen Ethnologie und angrenzender Disziplinen.
- Autorenportrait
- Beate Binder ist Professorin am Institut für Europäische Ethnologie und am Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien der Humboldt-Universität zu Berlin. Moritz Ege ist Doktorand am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität zu Berlin. Anja Schwanhäußer arbeitet als Stadtethnologin und Künstlerin in Berlin und Wien, zuletzt am Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien. Jens Wietschorke ist Assistent am Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien.
- Leseprobe
- Orte - Situationen - Atmosphären: Eine Einleitung Beate Binder, Moritz Ege, Anja Schwanhäußer und Jens Wietschorke Konkrete Orte und Situationen, städtische Atmosphären, geografische Imaginationen, kulturelle Typen und Figuren liefern den Stoff für die Beiträge, die in diesem Band versammelt sind: Sie dienen als Ausgangspunkte für skizzenhafte Kulturanalysen sozial-kultureller Konstellationen. Die Texte bewegen sich also gewissermaßen von konkreten Situationen zu historisch-kulturellen conjunctures, wie sie schon im Erkenntnisinteresse der klassischen Cultural Studies standen (zum Beispiel bei Stuart Hall, vgl. Lindner 2000a). Damit geben sie auch einen - fraglos partiellen, tentativen und hoffentlich anregenden - Einblick in aktuelle Forschungsgebiete, Methoden und Fragestellungen der Europäischen Ethnologie, der volkskundlichen oder empirischen Kulturwissenschaft und angrenzender Disziplinen. Gewidmet ist der Band Rolf Lindner und seiner kulturanalytischen Sensibilität. Der Kreis der AutorInnen setzt sich aus KollegInnen, SchülerInnen und FreundInnen zusammen, die sich dem Format des kulturanalytischen Essays auf unterschiedliche und unterschiedlich ernsthafte Art und Weise genähert haben - nicht mit dem Anspruch, das wissenschaftliche Werk Rolf Lindners umfassend zu würdigen, sondern vor allem, um etwas von seinem Forschungs- und Denkstil aufzugreifen und weiterzuführen. So schlägt sich in den Beiträgen viel von dem nieder, wozu Rolf Lindner die AutorInnen im Austausch, in der Zusammenarbeit wie im Zusammensein angeregt hat, sei es auf direktem Weg oder auf produktiven Umwegen. Nicht zufällig haben wir den Ansatz beim Konkreten und Topografischen gewählt. Er ermöglicht es, die besonderen Stärken einer Kulturwissenschaft vorzuführen, die qualitativ-empirisch vorgeht und eine grundlegende Offenheit gegenüber der sozialen Welt bewahrt, einen Respekt vor der Textur des Alltagslebens. Der Ansatz beim Konkreten bildet deshalb nicht nur einen zentralen rhetorischen Topos in der Darstellungsweise ethnografischer und kulturanalytischer Forschung, er bedingt auch die Forschungspraxis und das Gegenstandsverständnis - so wichtig es zugleich immer bleibt, die Fallstricke konkretistisch-lokalistischer Verkürzungen zu umgehen. Gerade theoriegeleitete Herangehensweisen erweisen ihre Qualität am empirischen Material, zum Beispiel in der Analyse spezifischer Orte und Situationen. Damit wollen wir auch Rolf Lindners Betonung des »Sehenlernens« aufgreifen, das er in seiner Forschung und Lehre als Voraussetzung kulturanalytischer Praxis versteht. Was einen Ort ausmacht, was sich dort ereignet, was er vielleicht besagen könnte, mit welchen anderen Orten und Vorstellungen ihn verschiedene Akteursgruppen in ihrer Praxis verknüpfen, das erschließt sich über eine Befremdung des alltäglichen Blicks, die Selbstverständlichkeiten thematisierbar macht. Das Sehen setzt Offenheit voraus, ein Sensorium für Stimmungen, Indizien und unerwartete Konstellationen: Es geht auch darum, nicht immer schon Bescheid zu wissen. Der Literat und Ethnograf Hubert Fichte nannte seinen großen, unvollendeten Zyklus von Romanen und Essays eine »Geschichte der Empfindlichkeit«. Fichte lässt sich - trotz seiner ethnologischen Affinitäten - schwerlich in eine akademische Disziplin eingemeinden, doch erinnert sein Titel an die Forderung, sich Erfahrungen auszusetzen, eben empfindlich zu bleiben. So ist die Orientierung am Konkreten letztlich weniger eine im engen Sinn methodische oder methodologische Frage als vielmehr eine Frage der Einstellung zum Gegenstand. Zu dieser gehört der Gestus, »sich den Hosenboden mit echter Forschung schmutzig zu machen«, wie der Chicagoer Stadtforscher Robert E. Park dies von seinen Mitarbeitern verlangte, das Eintauchen in andere Lebenswelten ebenso wie die Reflexion der Bedingungen solcher Alterität.