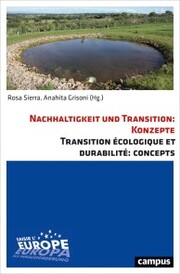Detailansicht
Nachhaltigkeit und Transition: Konzepte. Transition écologique et durabilité: Concepts
eBook - Sozio-ökologische Transformation aus deutsch-französischer Perspektive. Regards franco-allemand sur le changement socio-écologique
ISBN/EAN: 9783593437088
Umbreit-Nr.: 4247919
Sprache:
Deutsch
Umfang: 372 S., 5.10 MB
Format in cm:
Einband:
Keine Angabe
Erschienen am 09.11.2017
Auflage: 1/2017
E-Book
Format: PDF
DRM: Digitales Wasserzeichen
- Zusatztext
- Hervorgegangen aus dem Forschungsprojekt "Saisir l'Europe - Europa als Herausforderung" versammeln diese Bände Beiträge in deutscher und französischer Sprache zu Konzepten der Nachhaltigkeit und der ökologischen Transition. Im Zentrum des ersten Bandes stehen ethische und epistemologische Fragen: Wie und für wen soll Nachhaltigkeit gestaltet werden? Wie sollen dabei die natürlichen Grenzen des Planeten und die Phänomene des Anthropozäns berücksichtigt werden? Außerdem wird diskutiert, wie diese Konzepte in verschiedenen Disziplinen - Geschichte, Soziologie, Geografie - reflektiert werden. Der zweite Band umfasst Analysen politischer, ökonomischer und sozialer Fragen, die bei der Formulierung und Umsetzung von Zielen des Umweltschutzes, der Nachhaltigkeit und der ökologischen Transition eine zentrale Rolle spielen. Hier werden auch wichtige Akteure, ihre Initiativen und Praktiken vorgestellt.
- Kurztext
- Hervorgegangen aus dem Forschungsprojekt "Saisir l'Europe - Europa als Herausforderung" versammeln diese Bände Beiträge in deutscher und französischer Sprache zu Konzepten der Nachhaltigkeit und der ökologischen Transition. Im Zentrum des ersten Bandes stehen ethische und epistemologische Fragen: Wie und für wen soll Nachhaltigkeit gestaltet werden? Wie sollen dabei die natürlichen Grenzen des Planeten und die Phänomene des Anthropozäns berücksichtigt werden? Außerdem wird diskutiert, wie diese Konzepte in verschiedenen Disziplinen - Geschichte, Soziologie, Geografie - reflektiert werden. Der zweite Band umfasst Analysen politischer, ökonomischer und sozialer Fragen, die bei der Formulierung und Umsetzung von Zielen des Umweltschutzes, der Nachhaltigkeit und der ökologischen Transition eine zentrale Rolle spielen. Hier werden auch wichtige Akteure, ihre Initiativen und Praktiken vorgestellt.
- Autorenportrait
- Rosa Sierra ist Philosophin. Anahita Grisoni ist Soziologin. Sie leiten zusammen die Forschungsgruppe »Nachhaltigkeit« im Netzwerk »Saisir l'Europe Europa als Herausforderung«.
- Leseprobe
- Vorwort Europa steht heute vor Herausforderungen, die von vielen Zeitgenossen als historisch einzigartig betrachtet werden. Die Finanzkrise nach 2008 hat das Vertrauen in die Handlungsmacht der europäischen Institutionen wie in den Zusammenhalt der europäischen Staaten erschüttert; der gesellschaftliche und politische Umgang mit den Formen und Folgen intensivierter Migration sowie schließlich das Erstarken populistischer Bewegungen haben das Projekt der europäischen Integration in eine tiefe Repräsentations- und Legitimationskrise geraten lassen.Davon sind die Geistes- und Sozialwissenschaften nicht unberührt geblieben. Hatten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gerade aus diesen Fächern lange Zeit fortschreitende Europäisierung als Gewissheit angenommen und in ihren Forschungen die gedankliche Ordnung Europas sowie das Voranschreiten der Einigung nicht hinterfragt, so sehen auch sie sich heute neuen Herausforderungen gegenüber. Sind ihre Annahmen wachsender Verflechtung, " immer engerer Union " (wie es im Vertrag von Maastricht heißt) und einer entstehenden gemeinsamen europäischen Identität tatsächlich richtig?Der vorliegende Band ist Teil einer Reihe, die aus dem Projekt " Saisir l'Europe - Europa als Herausforderung " hervorgegangen ist. In diesem Projekt haben von 2012 bis 2017 sieben französische und deutsche Forschungsinstitutionen in einem Verbund zusammengearbeitet: die Humboldt-Universität zu Berlin, die Goethe-Universität Frankfurt, das Centre Marc Bloch in Berlin, das Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur l'Allemagne (CIERA), das Institut franco-allemand de sciences historiques et sociales in Frankfurt, das Deutsche Historische Institut Paris und die Fondation Maison des sciences de l'homme Paris. Darüber hinaus haben auch zahlreiche Partner-Institutionen in Frankreich und Deutschland mitgewirkt. Thematisch geht es in dem Vorhaben um einen neuen Zugriff auf die drängenden Probleme Europas. Dabei sind wir nicht von den politischen Fragestellungen des ins Stocken geratenen Einigungsprozesses ausgegangen. Vielmehr haben wir uns entschlossen, drei zentrale Themen aufzugreifen, mit denen derzeit die Gesellschaften Europas konfrontiert sind und deren Behandlung für die Zukunft des Kontinents von entscheidender Bedeutung ist: die Entwicklung des Sozialstaats und der sozialen Sicherung, die Frage der Nachhaltigkeit mit ihren Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Lebensform, schließlich die Probleme der Gewalt und Gewaltanwendung insbesondere in Ballungsräumen und städtischen Zentren. Zu jedem dieser drei Themen hat sich eine Forschungsgruppe konstituiert, die im Wesentlichen selbständig gearbeitet, zugleich aber die Querverbindungen zu den beiden anderen Gruppen gepflegt hat. Die konkrete Arbeit der drei Gruppen wurde jeweils von einem Tandem aus einem deutschen und einem französischen Postdoc geleitet, die auf diese Weise auch einen wesentlichen Anteil an der Ausbildung der Doktoranden geleistet haben.Das Projekt zeichnet sich durch eine Reihe von Merkmalen aus, deren Bündelung es von klassischen Forschungsvorhaben in den Geistes- und Sozialwissenschaften abhebt. Dazu gehören unter anderem: die durchgehende Mischung der Generationen von Doktoranden, Postdoktoranden und Senior Researchers, die durchgehende Kombination von Interdisziplinarität und Internationalität, die Verbindung von Forschung und Forschungsausbildung sowie die dichte Vernetzung von im deutsch-französischen Feld aktiven wissenschaftlichen Einrichtungen, die bisher noch nie so eng miteinander kooperiert haben. Für ein solches, auf fünf Jahre veranschlagtes Forschungsnetzwerk von dieser Größenordnung (insgesamt über 60 beteiligte Wissenschaftler) gab es in der deutschen und der französischen Forschungslandschaft keine einschlägigen Förderungsträger. Deshalb haben sich das Bundesministerium für Bildung und Forschung und das Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche zu einer Grundfinanzierung entschlossen, für die ihnen großer Dank geschuldet ist. Die beteiligten Institutionen haben ihrerseits eigene Mittel bereitgestellt. Weitere Mittel zur Durchführung der Gruppenarbeit konnten bei der Deutsch-französischen Hochschule eingeworben werden, der wir ebenfalls zu Dank verpflichtet sind. Der deutsch-französische Kern des Projekts ist kein Selbstzweck. Er funktioniert als Ausgangspunkt und erster Schritt zur Internationalisierung, vor allem für die Jüngeren unter den beteiligten Wissenschaftlern, zu denen im Übrigen auch Doktoranden und Postdoktoranden aus anderen Ländern wie Großbritannien und Italien oder aus Lateinamerika gehören. Internationalisierung bedeutet hier nicht nur Mehrsprachigkeit, sondern auch Kenntnis verschiedener akademischer Kulturen, Sensibilität für die Pluralität der methodischen Ansätze und vor allem reflexiver Umgang mit den eigenen Ausgangspositionen und mit den spezifischen disziplinären Vorgaben. Für alle diese notwendigen Ingredienzien gelungener Internationalisierung von europäischen Geistes- und Sozialwissenschaften - das hat sich auch wieder bei " Saisir l'Europe - Europa als Herausforderung " bestätigt - ist die deutsch-französische Konstellation ein besonders fruchtbares Feld. Die Arbeit an den analytischen Kategorien, die Auseinandersetzung mit der historischen Dimension des Zugangs auch zu aktuellen Fragen, schließlich die politischen Referenzen der Europa-Diskussionen erscheinen im deutsch-französischen Prisma in einprägsamer Schärfe, auch und gerade dann, wenn andere Positionen mitgedacht werden müssen. Europäische Forschung ist, das zeigt auch " Saisir l'Europe - Europa als Herausforderung ", ein Polylog, der auf einem dialogischen Prinzip aufbaut. Das soll in den Bänden dieser Reihe exemplarisch vorgeführt werden.Gabriele Metzler und Michael WernerSprecher des Forschungsnetzwerks " Saisir l'Europe - Europa als Herausforderung "Préface Pour nombre de contemporains, l'Europe fait aujourd'hui face à des défis sans précédent. La crise financière déclenchée en 2008 a porté atteinte à la confiance dans la capacité d'action des institutions européennes comme dans la cohésion des états de l'Europe. Les réactions, tant du point de vue de la sphère sociale que du monde politique, face l'accroissement des flux migratoires, réfugiés économiques ou politiques, travailleurs détachés, ainsi que le renforcement des mouvements populistes ont plongé le projet d'intégration européenne dans une crise profonde qui concerne à la fois les processus de représentation et légitimation démocratique.Les sciences humaines et sociales n'ont pas pu se tenir à l'écart de cette crise. Alors que les chercheurs issus de ces disciplines ont pendant longtemps considéré le processus de l'européanisation comme allant de soi et que leurs travaux n'ont interrogé ni les soubassements de l'architecture intellectuelle de la construction européenne ni les modalités d'avancement du chantier, ils se retrouvent aujourd'hui face à des défis inattendus. Leurs hypothèses sur des interpénétrations croissantes, sur une " union toujours plus étroite ", comme il est écrit dans le traité de Maastricht, sur l'éclosion d'une identité européenne commune se sont-elles effondrées ?Le présent volume s'intègre dans une série qui réunit les travaux issus du projet " Saisir l'Europe - Europa als Herausforderung ". De 2012 à 2017, ce projet a rassemblé au sein d'un réseau sept institutions d'enseignement supérieur et de recherche françaises et allemandes : la Humboldt-Universität de Berlin, la Goethe-Universität à Francfort/Main, le Centre Marc Bloch à Berlin, le Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur l'Allemagne (CIERA), l'Institut franco-allemand de sciences historiques et sociales à Francfort/Main, l'Institut historique allemand de Paris, et la Fondation Maison des sciences de l'homme Paris. D'autres institutions partenaires en France et en Allemagne ont également été associées au projet.Le projet vise à aborder à nouveaux frais des questions considérées comme cruciales pour la compréhension de l'Europe. Nous ne sommes pas partis des questions d'ordre politique que soulevaient les blocages du processus d'intégration européenne. Bien au contraire, nous avons identifié trois thématiques centrales auxquelles sont confrontées les sociétés européennes et qui nous apparaissent déterminantes pour le futur du continent européen. Il s'agit de l'évolution de l'Etat social et de la protection sociale, de la question du développement durable et de ses conséquences sur la société, l'économie et les modes de vie, et enfin des violences urbaines, dans les centres et les périphéries des métropoles. Autour de ces thèmes se sont constitués trois groupes de recherche, travaillant à la fois principalement de manière autonome mais également de manière transversale en établissant des ponts entre eux. Le travail concret au sein de chacun de ces trois groupes était piloté par un binôme de chercheurs post-doctorants français et allemand, contribuant ainsi fortement à la formation des doctorants.Le projet se distingue d'autres projets plus classiques en sciences de l'homme et de la société par un faisceau de particularités. On peut citer, entre autres, la cohabitation étroite entre différentes générations de cher-cheurs, doctorants, post-doctorants et chercheurs confirmés, la combinai-son constante entre interdisciplinarité et internationalisation, la mise en relation entre recherche et formation à la recherche, la mise en réseau resserrée de différents établissements d'enseignement supérieur et de recherche actifs dans le champ franco-allemand, qui n'auront jamais coopéré de manière aussi intense jusqu'à présent. Un projet d'une telle ampleur, il réunit environ soixante chercheurs, tous niveaux confondus, inscrit dans une durée de cinq ans, n'entrait dans aucun programme de soutien à la recherche prédéfini, ni en France ni en Allemagne. C'est pourquoi le Bundesministerium für Bildung und Forschung et le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ont pris la décision de soutenir financièrement le projet, et nous leur en sommes infiniment reconnaissants. Les institutions impliquées dans le réseau ont également apporté leur contribution en mobilisant des ressources propres. Enfin, l'Université franco-allemande a rendu possible différentes manifestations scientifiques du réseau pendant toute la durée du projet. Nous lui exprimons ici toute notre gratitude.Le noyau franco-allemand du projet n'est ni une fin en soi ni un hori-zon, mais bel et bien au contraire le fondement et la première étape d'une internationalisation, en premier lieu pour les plus jeunes des chercheurs impliqués dans le réseau, parmi lesquels se trouvent également des docto-rants et post-doctorants venant de Grande-Bretagne, d'Italie et d'Amérique du Sud. L'internationalisation ne se réduit pas ici simplement à la pratique de plusieurs langues, mais elle permet l'apprentissage de différentes cultures scientifiques et développe une sensibilité pour une pluralité d'approches méthodologiques et, surtout, promeut un retour réflexif sur les propres présupposés scientifiques et disciplinaires des participants. La constellation franco-allemande offre un terrain particulièrement fructueux pour faire éclore tous les ingrédients nécessaires à une internationalisation réussie des sciences humaines et sociales européennes, - " Saisir l'Europe - Europa als Herausforderung " en porte un témoignage parlant. Le travail sur les catégories analytiques, la réflexion sur la dimension historique de l'accès aux questions contemporaines, enfin les présupposés politiques des discours sur l'Europe apparaissent à travers le prisme franco-allemand dans toute leur acuité, et ce d'autant plus que d'autres points de vue entrent en ligne de compte. La recherche sur l'Europe, et c'est ce que montre " Saisir l'Europe - Europa als Herausforderung ", s'apparente à une polyphonie qui repose sur un principe dialogique. C'est que nous avons tenté de dé-montrer dans cette série.Gabriele Metzler et Michael WernerResponsables du réseau de recherche " Saisir l'Europe - Europa als Herausforderung " EinleitungDer vorliegende Band zur Nachhaltigkeit und ökologischen Transition versammelt Beiträge, die sich mit zwei Fragestellungen befassen: Erstens mit ethischen Fragen, die die Bedeutung der Idee und des Begriffs der Nachhaltigkeit betreffen. Zweitens mit epistemologischen Fragen, die sich aus der theoretischen, empirischen und praktischen Auseinandersetzung mit den Ideen und Begriffen " Nachhaltigkeit " und " ökologische Transition " für partikulare Disziplinen sowie interdisziplinäre Ansätze ergeben. Die Zentralität beider Fragestellungen geht auf den besonderen Kontext zurück, in dem die meisten der hier versammelten Beiträge vorgestellt und diskutiert wurden: das Forschungsprojekt " Nachhaltigkeit ", das im Herbst 2012 im Rahmen des deutsch-französischen Forschungsnetzwerks " Saisir l'Europe - Europa als Herausforderung " seine Aktivitäten startete. Diskussionen innerhalb und zwischen den vom Projekt geförderten Arbeitsgruppen in Frankfurt am Main und Lyon/Paris sowie öffentliche Veranstaltungen bildeten die Plattform, auf der sich die zentralen Themen entwickelten. 1.Konzepte Im deutsch-französischen Forschungskontext gewann die Auseinandersetzung mit dem Begriff " Nachhaltigkeit " bzw. " nachhaltige Entwicklung " und " durabilité " bzw. " développement durable " in einer Form an Bedeutung, die angesichts der intensiven Debatten um die zahlreich entworfenen Konzepte in den vergangenen Jahrzehnten überraschend sein dürfte. Bestimmte Thesen und Sichtweisen bezüglich der Bedeutung des Begriffs haben sich etabliert: Es handele sich um ein " contested concept " oder um eine Kompromissformel, deren Bedeutung nicht ganz zu bestimmen sei und sich gerade dadurch als geeignet dafür erweise, die öffentliche Diskussion zu motivieren. Doch die Betrachtung der Problemfelder hinter den Konzepten in zwei unterschiedlichen nationalen und sprachlichen Kontexten sowie aus der Perspektive von unterschiedlichen Disziplinen zeigt deutlich, dass Definitionsfragen nicht ausgeschöpft worden sind. Die Auseinandersetzung mit den Konzepten zielt in diesem Fall nicht auf die Etablierung einer allgemein gültigen Definition. Vielmehr geht es darum, die Pluralität in der Begriffskonstellation zum Ausgangspunkt zu machen und Konsequenzen daraus zu ziehen: Diese Pluralität zeugt nämlich von der Komplexität der Fragen und Probleme, die in jedem sprachlich-nationalen sowie disziplinären Kontext zu beobachten ist. Zwei zentrale Feststellungen haben sich daraus ergeben: (1) Während sich " Nachhaltigkeit " in Deutschland als Leitbegriff in der Wissenschaft und der Öffentlichkeit etabliert hat, weist seine direkte Übersetzung " durabilité " keine vergleichbare Resonanz in Frankreich auf. " Nachhaltigkeit " kann zudem eine Vielfalt von konkreten Bereichen - unter anderem Umweltschutz, Ressourceneffizienz, Gesundheit, Generationengerechtigkeit - betreffen. Dabei spiegelt sich die Vielfalt der Nachhaltigkeitskonzepte wider, die in den letzten Jahrzehnten debattiert wurden, insbesondere die Definitionen der nachhaltigen Entwicklung im Bericht der WCED und im Bericht des UNEP sowie die neueren Ansätze im Bereich der Umwelt- und Nachhaltigkeitsethik und der Nachhaltigkeitswissenschaften. Der Begriff " durabilité " hat dagegen eine begrenzte, zeitlich geprägte Bedeutung und außer spezifischen Anwendungen in konkreten Disziplinen findet er vor allem in den Sozialwissenschaften kaum Resonanz. (2) So wie der Begriff " nachhaltige Entwicklung " in Deutschland wird der Begriff " développement durable " sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Wissenschaft zwar angewendet und thematisiert, jedoch hat der Begriff der " transition écologique " breitere Aufmerksamkeit in den französischen Sozialwissenschaften gefunden, die sich nicht zuletzt seiner stärkeren politischen Prägung im Sinne sozialer Bewegungen verdankt. In dieser Hinsicht steht er im Kontrast zum Begriff " développement durable ", der stärker mit der politischen Institution bzw. mit Regierungsprogrammen identifiziert wird. " Transition écologique " hat im deutschen Kontext kein exaktes Pendant. Die Begriffe, die Aspekte des gesellschaftlichen Wandels zum Ausdruck bringen, sind in Deutschland vor allem diejenigen der " Energiewende " und der " sozialökologischen Transformation ", jedoch werden beide Begriffe ähnlich wie der Begriff " développement durable " weniger mit sozial-politischem Engagement und stärker mit etablierten politischen Programmen in Verbindung gebracht. Vor diesem Hintergrund erwiesen sich die Begriffe " Nachhaltigkeit " und " transition écologique " als Fokus für die weitere Diskussion und Forschung. Die Thematisierung beider Begriffe zusammen beruht auf der Annahme, dass sie im jeweils eigenen Kontext ähnliche Sorgen, Ideale und Prämissen verkörpern: Die Sorge um den gegenwärtigen, sich verschlechternden Zustand unserer Umwelt, darunter besonders der natürlichen Ressourcen und Räume, des Lebens und der Lebewesen auf dem Planeten, der Lebensqualität und Biodiversität, Ökosysteme und ihrer Gleichgewichte sowie der Verhältnisse zwischen ökologischen und gesellschaftlichen Kreisläufen. Auch normative Ideen, die einen durch Menschen herbeigeführten Wandel begleiten sollen, sind beiden Begriffen gemeinsam: die Idee einer Verbesserung unseres Umgangs mit Umwelt und Natur, die gleichzeitig die gesellschaftlichen Verhältnisse neu gestaltet unter Gesichtspunkten der Suffizienz, Gerechtigkeit, Respekt vor traditionellen und lokalen Lebensformen und Werten, Autonomie und Freiheit in der Gestaltung dieser Lebensformen, und vor allem nach dem Prinzip, dass alle Richtlinien des Wandels auf der Grundlage der politischen und gesellschaftlichen Beteiligung von allen Gruppen - und nicht nur ausgewählten Eliten - getroffen werden. Schließlich ist auch eine grundsätzliche Prämisse gemeinsam: dass Wandel möglich und nötig ist, die Gesellschaft dem Determinismus natürlicher Prozesse nicht ausgeliefert wird und der Mensch trotz der Kontingenz der historischen und sozialen Prozesse oder der systemischen Imperative Einfluss- und Handlungsmöglichkeiten erhält. Unter der Voraussetzung der Handlungsfähigkeit angesichts ökologischer Probleme und Krisenerscheinungen befassen sich die Beiträge im ersten Teil des vorliegenden Bandes mit normativen Leitideen, die dem Nachhaltigkeitsbegriff zugrunde liegen. Die Beiträge von John O'Neill und Catherine Larrère betrachten wirtschaftswissenschaftliche Ansätze der Nachhaltigkeit. Sie kritisieren jeweils unterschiedliche Aspekte, die sie als gemeinsam zu den Positionen in der Debatte zwischen starker und schwacher Nachhaltigkeit identifizieren und die es erlauben, die Kritik auf den wirtschaftswissenschaftlichen Ansatz selbst anzuwenden bzw. zu erweitern. John O'Neill kritisiert die Konzeption von Umweltgütern als Kapital sowie die Möglichkeit, verschiedene Kapitalarten gegeneinander zu ersetzen. Insbesondere zwei zugrundeliegende Annahmen dieser Konzeption betrachtet er kritisch: die Substituierbarkeit von Kapitalarten, die auf einer falschen Idee der Substituierbarkeit zwischen Dimensionen des Wohlergehens beruht, sowie die Art von Wertschätzung, die mit der Idee des Kapitals eingehergeht und Objekte nur aufgrund ihrer (Ökosystem-)Leistungen und nicht in ihrer (historisch gewachsenen) Partikularität bewertet. Catherine Larrère kritisiert die einseitige Interpretation der Idee der Grenzen, die dem Wachstum und den ökonomischen Aktivitäten im Rahmen der Nachhaltigkeitsdebatten zugeschrieben wird, als nur materielle Grenzen. Diese Interpretation ignoriert die Notwendigkeit, soziale Grenzen einzubeziehen und täuscht somit darüber hinweg, ökonomische Aktivitäten tatsächlich zu begrenzen und Nachhaltigkeit nicht nur als zeitliche Erhaltung von Kapitalarten zu verstehen. Die Beiträge von John Nolt und Susanne Hiekel befassen sich mit der klassischen Frage der Umweltethik, wie die Reichweite der moralischen Gemeinschaft konzipiert werden kann, die Nachhaltigkeitsansprüche erheben darf. Während Susanne Hiekel für eine Erweiterung der anthropozentrischen Sicht und die Berücksichtigung aller empfindungsfähigen Tiere plädiert, entwickelt John Nolt aus einer biozentrischen Perspektive die Idee eines nachhaltigen Wohlergehens aller Lebewesen bzw. des Lebens selbst und erläutert ausführlich, wie dies eingeschätzt werden kann. Schließlich nehmen die Beiträge von Konrad Ott und Rosa Sierra weitreichende Perspektiven ein und analysieren Konzepte der Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit prominenten moralischen Begriffen. Konrad Ott betrachtet zentrale Handlungsfelder im Anthropozän und analysiert die Herausforderungen, die sie für das Ziel der nachhaltigen Entwicklung darstellen. Auf der Grundlage einer diskurs- und verantwortungsethisch erfassten Grundeinstellung der " tiefen Sorge " einerseits und eines Ebenen-Modells starker Nachhaltigkeit andererseits erarbeitet Ott Anhaltspunkte für eine deliberative Klugheitsethik, die angesichts von Konfliktpotenzialen zwischen gesellschaftlichen Bedingungen und menschenrechtlichen Ansprüchen vermitteln soll und sich gegen kosmopolitisch-idealistische Ansätze der globalen Gerechtigkeit in Stellung bringt. Genau dieses Konzept der globalen Gerechtigkeit greift Rosa Sierra auf und betrachtet die Verbindung, die zwischen Nachhaltigkeitszielen und globaler Gerechtigkeit etabliert worden ist. Sie analysiert ausführlich, inwiefern es behauptet werden könnte, dass Nachhaltigkeitsziele zu verwirklichen nur dann möglich ist, wenn wir gleichzeitig Ansprüche der globalen Gerechtigkeit anerkennen und erfüllen. Die Argumente, die dafür sprechen, gründen einerseits auf moralischen Überlegungen im Blick auf Armutsbedingungen und ihre Bekämpfung auf internationaler Ebene und andererseits auf einer global konzipierten Umsetzung der Nachhaltigkeit, die sozial-ökologische Prozesse auf globaler Ebene berücksichtigt. Letzteres verdeutlicht aber zugleich die Notwendigkeit, über die WCED-Definition der nachhaltigen Entwicklung hinauszugehen und auch für die moralische Reflexion Konzepte aufzugreifen, wie sie im Bereich der empirischen Nachhaltigkeitsforschung erfasst werden.2.Disziplinen Die Handlungsfähigkeit bzw. die Rolle des Subjekts bei der Betrachtung und Erklärung von Phänomenen ist typischerweise in Ansätzen zu finden, die in den Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften gehören. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Umwelt und ökologischen Prozessen ist ursprünglich von naturwissenschaftlichen Ansätzen stark geprägt worden, da Biologie, Chemie und Physik zu deren Grundlage gehören. Trotz aller Kritik an manchen Nachhaltigkeitskonzepten als Kompromissformeln wird es als Errungenschaft angesehen, dass dabei Sorgen um die Natur und die natürliche Umwelt bzw. Motive des Natur- und Umweltschutzes einerseits und menschliche und gesellschaftliche Probleme und Bedürfnisse andererseits verbunden werden. Die früheren Debatten, die zur Formulierung und Diskussion eines Konzeptes der " nachhaltigen Entwicklung " dienten, hatten gerade diese Vereinbarung zum Ziel: sowohl die Interessen von Umwelt- und Naturschützern als auch denjenigen, die sich für soziale Ziele und Armutsbekämpfung einsetzten. Nicht die anfangs angebotenen Formeln einer nachhaltigen Entwicklung und eines " Dreiecksmodells " bilden die Errungenschaft - dafür sind beide Konzepte überzeugend kritisiert und weiterentwickelt worden. Das Zusammendenken von natürlichen und gesellschaftlichen Prozessen, die Anerkennung der gesellschaftlichen Angewiesenheit auf natürliche Grundlagen und die Relativierung der Konzeption einer vom Menschen strikt getrennten, ihm externen Natur sind dagegen die zentralen Erkenntnisse, auf denen die gegenwärtigen Bemühungen für Nachhaltigkeit und Transition ansetzen. Im Bereich der Wissenschaft spiegelt sich diese gegenwärtige Einsicht in disziplinenübergreifenden Forschungsansätzen wider, die die Zusammenarbeit zwischen Natur- und Sozial- und Geisteswissenschaften umsetzen. Auch die spezifisch transdisziplinären Forschungsansätze setzten den Leitfaden um, die Perspektive der Subjekte, insbesondere der von Umweltproblemen Betroffenen, in den Forschungsprozess einzubeziehen. Vor allem unter dem Gesichtspunkt des wichtigen Stellenwerts, den transdisziplinäre Ansätze in der Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung eingenommen haben, bedarf die Entscheidung, die Einbeziehung der Begriffe " Nachhaltigkeit " und " transition écologique " in den Objektbereich einzelner Disziplinen zu thematisieren, der weiteren Erläuterung: Es ist aber gerade infolge der Prominenz der transdisziplinären Ansätze nicht nur im Rahmen konkreter Forschungsprojekte, sondern auch bei der Konzeption von disziplinenübergreifenden Studiengängen von Bedeutung, dass die Konsequenzen und Herausforderungen der wissenschaftlichen Betrachtung von Nachhaltigkeit und Transition innerhalb der Einzeldisziplinen reflektiert werden, da sie bislang unterbelichtet blieben. Die disziplinäre Perspektive soll jedoch weniger als Alternative dazu und eher als wichtiges Gegenstück zu den disziplinenübergreifenden Herangehensweisen zur Geltung gebracht werden, denn in beiden Fällen dürften unterschiedliche Erkenntnisinteressen - wenn nicht zu radikal anderen Ergebnisse -, doch zur Betonung von Aspekten dienen, die aus der jeweils anderen Perspektive nicht deutlich sichtbar werden.