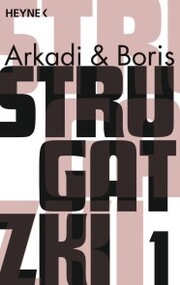Detailansicht
Gesammelte Werke 1
eBook - 3 Romane in einem Band: Die bewohnte Insel; Ein Käfer im Ameisenhaufen; Die Wellen ersticken den Wind
ISBN/EAN: 9783641041298
Umbreit-Nr.: 1640423
Sprache:
Deutsch
Umfang: 912 S., 1.99 MB
Format in cm:
Einband:
Keine Angabe
Erschienen am 19.04.2010
Auflage: 1/2010
E-Book
Format: EPUB
DRM: Digitales Wasserzeichen
- Zusatztext
- <b>Das Gesamtwerk der russischen Ausnahme-Autoren</b><br /><br />Arkadi und Boris Strugatzki gelten als die unumstritten besten Autoren der osteuropäischen Science Fiction. Ihr Werk wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und erschien in Millionenauflage. Der erste Band des Gesamtwerks enthält die Maxim-Kammerer-Trilogie mit den Einzelromanen "Die bewohnte Insel", "Ein Käfer im Ameisenhaufen" und "Die Wellen ersticken den Wind".
- Autorenportrait
- Arkadi (geboren 1925, gestorben 1991) und Boris (geboren 1933) Strugatzki zählen zu den bedeutendsten und erfolgreichsten russischen Autoren der Nachkriegszeit. Ihre Romane sind nicht nur faszinierende Parabeln über die Stellung des Menschen im Universum, sondern auch schonungslose Abrechnungen mit Ideologiegläubigkeit und Personenkult. Viele ihrer Romane wurden verfilmt " darunter Andrej Tarkowskijs Stalker nach »Picknick am Wegesrand«.
- Leseprobe
- Ich bin mit Arkadi und Boris Strugatzki groß geworden.<br />Als Kind, als Mensch überhaupt - und auch als Autor. Ungefähr mit neun Jahren habe ich begonnen, ihre Bücher zu lesen. Ich habe sie alle gelesen, jedes viele Male, habe sie mir immer wieder vorgenommen - wenn es mir schlecht ging, wenn ich mich einsam fühlte, wenn mir langweilig war, wenn ich mit jemandem reden und von jemandem lernen wollte, der unendlich viel klüger und subtiler war.<br />Daran ist nichts Außergewöhnliches. Ich bin jetzt dreißig, und die Strugatzkis las jeder meiner Klassenkameraden, jeder meiner Kommilitonen; schon unsere Eltern hatten die Strugatzkis verschlungen; heute lesen die Strugatzkis die Fünftklässler und die Studenten an der Universität. Die Auflage ihrer Bücher allein in russischer Sprache nähert sich fünfzig Millionen, Übersetzungen sind in über dreißig Sprachen erschienen. Die Strugatzkis haben zahllose Fanclubs und Hunderte von Nachahmern; in den Welten, die sie in ihren Büchern erschaffen haben, sind Dutzende Romane anderer Autoren angesiedelt. Von den Büchern der Strugatzkis trennt man sich nicht - sie bleiben in dir, und du bleibst in ihnen, um gemeinsam mit ihren Helden zu leben, zu kämpfen, zu suchen, zu lieben.<br />Der Form nach sind Arkadi und Boris Strugatzki natürlich Science-Fiction-Autoren. Doch meiner Ansicht nach - und Millionen andere Bewunderer ihres Werks werden mir zustimmen - sind sie richtige Schriftsteller ohne Wenn und Aber. Facettenreiche, ernsthafte, subtile, ungewöhnliche und sehr kraftvolle Schriftsteller.<br />In Russland - wie wohl in der ganzen Welt - wird die Science Fiction traditionell zur Trivialliteratur gezählt. Die Kritik ignoriert Neuerscheinungen in diesem Genre, Science-Fition-Romane gewinnen keine angesehenen Preise, man widmet ihnen keine Kolumnen in den Morgenzeitungen, und die Wochenblätter machen keine Interviews mit den Autoren. Vielleicht liegt das daran, dass man glaubt, die Anhänger dieses Genres wüssten sprachliche Feinheiten nicht zu schätzen, interessierten sich nicht für das tiefgründige Ausloten von Charakteren, könnten den Details der philosophischen Konstruktion eines Autors nicht folgen - was ein Science-Ficton-Leser vor allem verlange, seien Unterhaltung und Action.<br />Daran mag das eine oder andere stimmen, das eine oder andere ein Vorurteil sein, die sowjetische Science Fiction allerdings - nicht die neue russische, sondern eben die sowjetische - war ein in der Literaturwelt absolut einmaliges Phänomen. »Wir sind geboren, um das Märchen wahr zu machen«, heißt es in einem berühmten sowjetischen Lied, und der Science Fiction war in der UdSSR in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle zugedacht: ihre Romane sollten dem »Homo sovieticus« seine glückliche Zukunft zeigen. Nachdem sie alle Kreise der Zensur und Abgleichungen durchlaufen hatten, waren die Science-Fiction-Bücher just jene Märchen, die der Staat vorgeblich wahr zu machen gedachte. In einem Land, in dem der Staat für alles verantwortlich ist und jedes gedruckte Buch absegnet, muss die Zukunft licht und glücklich sein. Denn jedes düstere Zukunftsszenario würde ja voraussetzen, dass schon heute Fehler möglich sind, dass die Grundlagen für die künftige Katastrophe schon heute gelegt werden - doch das System wollte als unfehlbar erscheinen.<br />Die sowjetische Science Fiction sollte nicht unterhalten und nicht warnen wie die westliche. Ganz im Gegenteil: Sie war berufen, die Richtung zu weisen, Versprechungen zu machen. Sie sollte Bilder von der Gesellschaft der Zukunft zeichnen als einer gerechten Ordnung, die aus lauter klugen, ehrlichen und gütigen Menschen besteht, uneigennützig, ausschließlich befasst mit Forschung und Schöpfertum.<br />Die ersten Bücher der Brüder Strugatzki passten genau in dieses Schema. »Der Weg zur Amalthea«, »Praktikanten«, »Mittag, 22. Jahrhundert« - das ist typisch sowjetisches Heldenpathos unter phantastischen Umständen, der Mensch im Konflikt mit den Naturgewalten. Diese Romane wurden um 1960 herum geschrieben: das Chrusc abgelegenen Planeten führen wissenschaftliche Experimente zu einer globalen Katastrophe; alle Erdenmenschen, die sich auf dem Planeten befinden, sind zum Untergang verurteilt.<br />Das kommunistische »Missionieren« der UdSSR in Ländern der Dritten Welt, in Afrika und Asien, während der 1960er Jahre fand seinen Widerhall in dem Roman »Es ist schwer, ein Gott zu sein«: Der Held versucht, einem Planeten, dessen Bewohner sich in einem finsteren Mittelalter befinden, die Zivilisation zu bringen - und nimmt selbst die örtlichen Sitten an. Die Strugatzkis fragen sowohl sich selbst als auch die Leser, ob man Zivilisationsprozesse wirklich beschleunigen kann. Soll man sich überhaupt in die Gesellschaftsordnung, in die Kultur und die Geschichte anderer Völker einmischen? Das war eine der ersten Gelegenheiten, bei der diese Frage »denen da oben« gestellt wurde.<br />1965 folgte ein scheinbar völlig unschuldiger Roman: »Der Montag fängt am Samstag an«. Ein Zaubermärchen über die Romantik der sowjetischen Wissenschaft, ein liebenswertes Buch, ohne jede Düsternis, geradezu utopisch. Ich habe es als Kind mit großem Vergnügen immer wieder gelesen, eben als Märchen. Erst viel später habe ich verstanden, dass die Strugatzkis, die eine immer engagiertere, immer politischere Position einnahmen, darin in Wahrheit von der Konfrontation der seriösen sowjetischen Wissenschaftler mit den wissenschaftlichen Scharlatanen erzählten - ein Reflex auf den bizarren »Krieg«, den Trofim Lyssenko, ein Günstling Stalins, gegen die Erkenntnisse der Genetik führte.<br />Mit jedem neuen Werk der Strugatzkis wird in dieser Zeit sichtbar, wie die Autoren immer weniger an die von ihnen und anderen erfundene »lichte Zukunft« glauben; wie ihnen klar wird, dass die Fehler im System niemals eine Verwirklichung der idealistischen Szenarien erlauben werden. <br />