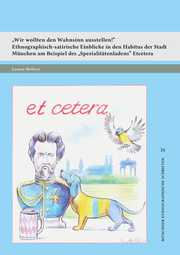Detailansicht
'Wir wollten den Wahnsinn ausstellen!'
eBook - Ethnographisch-satirische Einblicke in den Habitus der Stadt München am Beispiel des 'Spezialitätenladens' Etcetera, Münchner ethnographische Schriften
ISBN/EAN: 9783831676361
Umbreit-Nr.: 1000453
Sprache:
Deutsch
Umfang: 102 S., 16.62 MB
Format in cm:
Einband:
Keine Angabe
Erschienen am 26.02.2021
Auflage: 1/2021
E-Book
Format: PDF
DRM: Digitales Wasserzeichen
- Zusatztext
- Was soll das denn? Eine Uhr, die rückwärts läuft, ein Qu adratmeter Freistaat Bayern als Handtuch, eine bayerische Ehrenweißwurst als Auszeichnung, T-Shirts mit Bekenntnissen, wie Ich bin gegen alles oder Ich ertrage nur das Glück oder ein Globus, der allein Bayern zeigt. Dazu die berühmtesten KarikaturistInnen und Satire-KünstlerInnen der Epoche wie Loriot, Janosch, Ungerer, Sempé oder Flora vereint in einer Wunderkammer. Im Jahr der Studentenbewegung, 1968, hatten Helmut und Meisi Grill die Idee den Wahnsinn auszustellen. Sie gründeten den Souvenir- und Kuriositätenladen namens Etcetera, der auch Spezialitätenladen oder Anti-Supermarkt genannt wurde. Während der Bestehenszeit dieses Geschäft s von 1968 bis 2004 ist München geprägt von den Schwabinger Krawallen und Studentenrevolten, von sexueller Befreiung, dann Modernisierung und Technisierung. Die Nackerten tummeln sich im Englischen Garten und die Spider Murphy Gang besingt den Sommer in der Stadt. Helmut Dietl prägt die städtische Filmgeschichte, genau wie Rainer Werner Fassbinder. Auch Loriot, einer der größten deutschen Humoristen, und viele andere gehen in das kollektive Gedächtnis der Stadt ein. Diese kulturelle Codierung, die städtischen Eigenheiten und Artikulationen, die eingeschriebene Identität, verankern sich im Habitus der Stadt. Ausgehend von einer städtischen Spezifik behandelt die vorliegende Arbeit folgende Fragen: Inwiefern findet sich diese Spezifik Münchens im Souvenir- und Kuriositätenladen Etcetera wieder? Kann man, nach Rolf Lindner, gar einen Habitus der Stadt dort exemplarisch erkennen? Und mehr noch: Inwieweit sind die Verkaufsgegenstände während des Bestehens des Ladens Ausdruck eines stadttypischen Zeitgeistes? Inwieweit können Orte, wie ein derartiger Spezialitätenladen, mit seinen Gegenständen und Verkaufsobjekten kulturelles Wissen transportieren?