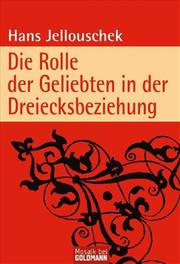Detailansicht
Die Rolle der Geliebten in der Dreiecksbeziehung
Mosaik
ISBN/EAN: 9783442169818
Umbreit-Nr.: 1303005
Sprache:
Deutsch
Umfang: 126 S.
Format in cm: 1.3 x 18.5 x 12.7
Einband:
kartoniertes Buch
Erschienen am 09.06.2008
- Zusatztext
- Das Standardwerk - vom erfahrenen und renommierten Paartherapeuten Die Geliebte, die Betrogene, der Mann - diese Konstellation ist für jeden Beteiligten kompliziert, schmerzhaft und belastend. Der erfahrene Paartherapeut Dr. Jellouschek macht anhand von Figuren der klassischen Mythologie Rolle für Rolle begreifbar und deckt tiefer liegende Ursachen von Beziehungsdreiecken auf. Nicht um Schuld, sondern um Klarheit in der Verwirrung der Gefühle geht es, damit der Weg für Veränderungen frei wird.
- Autorenportrait
- Dr. Hans Jellouschek, Jahrgang 1939, ist Eheberater, Psychotherapeut und Lehrtherapeut für Transaktionsanalyse. Er hat eine psychotherapeutische Praxis mit Schwerpunkt Paartherapie. Seit 25 Jahren ist er in der Fort- und Weiterbildung von Therapeuten und
- Leseprobe
- Eine olympische Dreiecksgeschichte Ich beginne dieses Buch mit einer uralten Geschichte, wie sie uns die griechische Mythologie vom Göttervater Zeus, seiner Gattin Hera und seiner Geliebten Semele überliefert. Als Leserin oder Leser werden Sie sich wahrscheinlich wundern, dass ich ein menschlich-allzumenschliches Thema wie das der Dreiecksbeziehung so hoch 'aufhänge' und den antiken Götterhimmel dafür bemühe. Das hat einen inneren und äußeren Grund. Der innere liegt darin, dass mythologische Erzählungen wie diese oft mit einer unnachahmlichen Prägnanz menschliche Schicksalskonstellationen abbilden und sich viele Menschen deshalb darin besser wiederfinden und verstanden fühlen, als es durch 'reale' Beispiele erreichbar wäre. Der äußere Grund ist der, dass dieses Buch ursprünglich in einer Reihe erschienen ist, die der psychologischen Interpretation alter Mythen gewidmet war. Hier also die alte Geschichte: Göttervater Zeus liebte die sterbliche Semele, die Tochter des thebanischen Königspaares Kadmos und Harmonia aus dem Geschlecht der Agenor, und unterhielt mit ihr - verborgen in menschlicher Gestalt - ein heimliches Verhältnis. Die rechtmäßige Gattin des Zeus, die Göttin Hera, kam jedoch dahinter. Eifersüchtig sann sie auf Rache, nahm die Gestalt von Semeles Amme an, verschaffte sich unerkannt Zutritt zum Königspalast und redete Semele ein, sie würde göttliche Ehren erlangen, wenn sie Zeus dazu veranlasste, sich ihr in seiner göttlichen Gestalt zu zeigen. Semele fiel auf diese List herein. Sie überredete Zeus, ihr die Erfüllung eines ungenannten Wunsches zuzusichern. Zeus ging darauf ein, und sie verlangte von ihm, sich ihr in seiner wahren Gestalt zu zeigen. Zeus fühlte sich durch sein göttliches Wort gebunden und betrat beim nächsten Mal angetan mit dem Zeichen seiner göttlichen Macht, den Wolken, dem Regen, den Winden, dem Donner und mit seinem unentrinnbaren Blitzstrahl, Semeles Gemach. Diese vermochte der göttlichen Gewalt nicht standzuhalten und verbrannte an seinem Blitz. Der sterbenden im sechsten Monat Schwangeren schnitt Zeus das Kind aus dem Leib und pflanzte es sich in seinen Schenkel, um es dort bis zur Geburt auszutragen. Dieses Kind war der Gott Dionysos, der Semele aus der Unterwelt befreite und mit ihr, der unsterblich Gewordenen, zum Götterhimmel emporstieg. Dieser Geschichte begegnete ich 1985 in Gestalt der Oper 'Semele' von Georg Friedrich Händel in einer hinreißenden Aufführung der Ludwigsburger Festspiele. Händel hatte für die Komposition ein Textbuch verwendet, das auf den zu seiner Zeit bekannten englischen Dichter W. Congreve (1670-1729) zurückging, der die Geschichte mit Hilfe weiteren mythologischen Materials aus anderen Zusammenhängen ausgestaltet und mit einer Vorgeschichte versehen hatte. Diese Vorgeschichte erzählt, dass die Königstochter Semele von ihrem Vater Kadmos dem Prinzen Athamas versprochen war. Von diesem wollte Semele jedoch nichts wissen, sie flehte Zeus um Rettung an und wurde von diesem in Gestalt eines Adlers entführt und an einen geheimen Ort gebracht, wo die beiden ihre Liebe leben konnten, bis die Affäre von Hera aufgedeckt wurde. Schon während der Aufführung der Oper drängte sich mir der Eindruck auf, dass hier nicht bloß eine uralte, aber belanglose Geschichte erzählt wurde, deren einziger Zweck es war, Anlass für Musik und schönen Gesang zu sein. Schon Händel und sein Textdichter sahen in der Geschichte einen durch die damaligen Vorgänge am englischen Königshof höchst aktuellen Konflikt widergespiegelt: den Konflikt zwischen Tugend, Vernunft und Staatsräson einerseits und der spontanen Liebe und Leidenschaft andererseits. In Zeus sollte der englische König Georg II. sich selbst erkennen, in Hera seine Gattin und in Semele seine bevorzugte deutsche Mätresse. Der Regisseur der Aufführung wies auf diese Aussageabsicht der Autoren hin, indem er die Figuren der Geschichte in Kostümen des 18. Jahrhunderts spielen ließ, weitete diese Deutung aber ins Allgemeinmensc