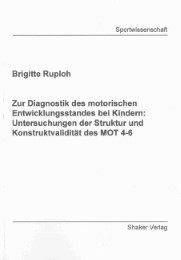Detailansicht
Zur Diagnostik des motorischen Entwicklungsstandes bei Kindern: Untersuchungen der Struktur und Konstruktvalidität des MOT 4-6
Berichte aus der Sportwissenschaft
ISBN/EAN: 9783844029802
Umbreit-Nr.: 7028450
Sprache:
Deutsch
Umfang: XVIII, 302 S., 62 Illustr.
Format in cm: 2 x 21 x 15
Einband:
kartoniertes Buch
Erschienen am 28.08.2014
- Zusatztext
- Der vor einem psychomotorischen Hintergrund konstruierte MOT 4-6 (Zimmer & Volkamer, 1987; Neuauflage mit neuen Normen voraussichtl. Anfang 2015) ist ein Test zur Erfassung des motorischen Entwicklungsstandes von 4- bis 6-jährigen Kindern. Der Test zeichnet sich u. a. aus durch die Fülle der erfassten motorischen Facetten, die Kindzentrierung, die ökologische Validität der Materialien und die für diesen Altersbereich angemessene Zurückhaltung gegenüber Leistungskriterien (vgl. Zimmer, 2015). Das in dem Einführungsteil des Buches dargelegte Bedingungsgefüge von Geist, Körper, Selbstkompetenzen, Pädagogik und Motodiagnostik macht die Bedeutung der motorischen Entwicklung für die kindliche Entwicklung insgesamt deutlich. Der MOT 4-6 wird im Hinblick auf seine Testgüte umfassend geprüft (Psychometrik, innere Struktur und Konstruktvalidität). Einige Ergebnisse: Das von den Testautoren deduktiv abgeleitete Modell der Zuordnung der Testitems zu motorischen Bereichen wird annähernd bestätigt (konfirmatorische Strukturgleichungsmodellierung). Darüber hinaus differenzieren exploratorische Faktorenanalysen zwei sinnvoll zu interpretierende, mit akzeptabler interner Konsistenz ausgestattete Komponenten ("Top-down" vs. "Bottom-up"), deren Benennung sich auf die jeweils stärker betonte - mehr innengesteuerte oder mehr kontextsensible - Steuerungsform in der Aufgabenbewältigung bezieht und damit auf zwei Formen oder Aspekte der Bewegungssteuerung, die bereits in den Anfängen der Psychomotorik thematisiert wurden. Die wissenschaftliche und praktische Bedeutung dieser beiden Komponenten zeigt sich u. a. darin, dass sie unterschiedliche Beziehungen zu sprachlichen und sozialen Kompetenzen aufweisen (Mediations- und Cross-lagged-panel-Analysen).