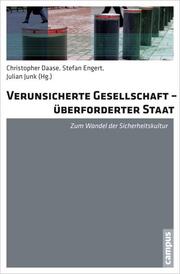Detailansicht
Verunsicherte Gesellschaft - überforderter Staat
Zum Wandel der Sicherheitskultur
ISBN/EAN: 9783593398730
Umbreit-Nr.: 4210911
Sprache:
Deutsch
Umfang: 391 S.
Format in cm: 2.5 x 21.4 x 14.2
Einband:
Paperback
Erschienen am 18.04.2013
Auflage: 1/2013
- Kurztext
- InhaltsangabeInhalt Gesellschaftliche Verunsicherung als Herausforderung des Staates: Eine Einführung Christopher Daase/Stefan Engert/Julian Junk9 I. Terrorismus Bedingt abwehrbereit: Politische und administrative Reaktionsmuster auf das >Terrorrisiko< Ulrich Schneckener35 Haben wir gewonnen? Die Messbarkeit von Sicherheit im Anti-Terror-Kampf Alexander Spencer57 Sicherheit ohne Angst: Terrorismusbekämpfung im 21. Jahrhundert Jürgen Maurer77 Sicherheit zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Ein Praxisbericht aus dem Luftverkehr Volker Zintel93 II. Cybersecurity Cybersicherheit in der Wissensgesellschaft: Zum Zusammenhang von epistemischer und physischer Unsicherheit Sandro Gaycken109 Gesellschaft im Daueralarm: Gefahrendarstellungen im Cybersecurity-Diskurs Myriam Dunn Cavelty133 III. Gesundheitliche Risiken Lassen sich globale Gesundheitsrisiken regulieren? Wirksamkeit und Grenzen internationaler Gesundheitsvorschriften Susanne Weber-Mosdorf153 Souverän durch die Krise: Überforderte Staaten und die (Selbst-)Ermächtigung der WHO Tine Hanrieder/Christian Kreuder-Sonnen169 Gib Versicherheitlichung keine Chance: Der frühe AIDS-Diskurs in den demokratischen Institutionen der BRD Stefan Engert187 Pandemie als Geschäftsidee: Eine Streitschrift wider die Interessenkonflikte im Gesundheitswesen Wolfgang Wodarg211 IV. Energiesicherheit Deutschlands Energiewende: Gesellschaftliche Hypersensibilität und der Verlust strategischer Versorgungssicherheit Frank Umbach.235 Sinn und Zweck der Nachhaltigkeitstransformation: Von ontologischer Unsicherheit zu sozioökologischer Resilienz Jörg Friedrichs259 V. Wirtschafts- und Finanzrisiken Finanzialisierung politischer Sicherheit: Das Beispiel der >Euro-Rettung< Andreas Langenohl279 Quo vadis, Wohlfahrtsstaat? Erfahrungen von Arbeitslosigkeit und Demokratiezufriedenheit im europäischen Vergleich Thorsten Faas299 VI. Menschliche Sicherheit Menschliche Sicherheit: Fallstricke eines wirkungsmächtigen Konzepts Tobias Debiel/Sascha Werthes319 Sicherheit, Frieden und Entwicklung: Die Veränderung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit Christine Meissler337 Wenn Elefanten ka?mpfen: Der politische Missbrauch der Humanita?ren Hilfe im Namen der Sicherheit Ulrike von Pilar349 Human Security zwischen staatlicher Instrumentalisierung und Weltgesellschaftspolitik: Ein Kommentar Lothar Brock371 Autorinnen und Autoren389
- Autorenportrait
- Christopher Daase ist Professor für Internationale Organisation an der Universität Frankfurt. Stefan Engert, Dr. phil., und Julian Junk, M.A., sind dort wissenschaftliche Mitarbeiter.
- Leseprobe
- Gesellschaftliche Verunsicherung als Herausforderung des Staates: Eine Einführung Christopher Daase/Stefan Engert/Julian Junk Sichere Gesellschaften fordern immer mehr Sicherheit. Der Staat, traditionell verantwortlich für die Sicherheitsgewährleistung, gerät dadurch an die Grenzen seiner Steuerungsfähigkeit. In Zeiten globaler Risiken ist er allein schon durch seine territoriale Begrenztheit in seinen Kapazitäten eingeschränkt, die wachsenden Sicherheitsbedürfnisse seiner vielfach verunsicherten Bevölkerung vollständig zu befriedigen. Gleichwohl machen politische Entscheidungsträger immer größere Sicherheitsversprechen, die ihr Verwaltungsapparat in Zeiten begrenzter Haushaltsbudgets kaum mehr einzulösen vermag. Damit befindet sich der Staat in einer paradoxen Situation. Je mehr Sicherheit er bereitstellt, desto weitgehender werden die gesellschaftlichen Sicherheitsanforderungen und desto weniger ist er selber in der Lage, diese zu befriedigen. Der Staat wird zum Opfer seines eigenen Erfolgs. Dies, so legen es die Beiträge des ersten Bandes dieser Buchreihe nahe, ist einer der Haupteffekte des Wandels der Sicherheitskultur (vgl. Daase et al. 2012). Während der erste Band den Begriff der Sicherheitskultur konzeptionell schärfte sowie den Wandel der Sicherheitskultur auf gesellschaftlicher und staatlicher Ebene beschrieb, untersucht der vorliegende Band die Folgen dieses Wandels für die Sicherheitspolitik in unterschiedlichen Politikfeldern. Die Analysen basieren auf einem liberalen Politikmodell, das die innenpolitischen Faktoren von Sicherheitspolitik ins Zentrum rückt und das wir im Folgenden kurz umreißen werden. Im zweiten Abschnitt gehen wir nochmals auf die Erweiterung des Sicherheitsverständnisses in den letzten Jahrzehnten ein und formulieren anhand von vier Dimensionen die dadurch entstandenen Herausforderungen für die Sicherheitspolitik. In diesem Zusammenhang kommt der Kommunikation von Gefahr und Sicherheit und dem Zusammenwirken von Laien- und Expertenwissen im Rahmen einer demokratischen Sicherheitspolitik eine zentrale Rolle zu. Der dritte Teil dieser Einleitung widmet sich daher in aller Kürze dem Zusammenwirken von Politik, Gesellschaft und Wissenschaft bevor im vierten Teil ein Überblick über die Beiträge dieses Bandes gegeben wird. Das liberale Politikmodell und die verschiedenen Ebenen der Sicherheitspolitik Das liberale Politikmodell, das diesem Band zugrunde liegt (vgl. Putnam 1988; Gourevitch 2002), bricht mit der immer noch verbreiteten Annahme, dass die Formulierung von Sicherheitspolitik allein Sache des Staates - also der Regierung - ist und ausschließlich von oben entschieden wird. Die Vorstellung, dass der Staat eine monolithische Handlungseinheit ist (vgl. Waltz 1979), Sicherheitspolitik eine exklusive Domäne der Regierung und ein "Primat der Außenpolitik" existiert (Ranke in Heffter 1951: 1), greift in Zeiten weitgehend entterritorialisierter funktionaler Räume zu kurz: Sie ist nicht länger angemessen, um die moderne, durch Interdependenz und Akteurspluralität gekennzeichnete internationale Gesellschaft und ihre Entscheidungsprozesse zu verstehen. Zwar bestätigen auch die hier vorgelegten Analysen, dass dem Staat immer noch eine zentrale Rolle als policy maker zukommt, sie verstehen ihn aber gleichzeitig als Produkt der dominanten gesellschaftlichen Interessengruppen und Präferenzen (Moravcsik 1997: 519). Die liberale Perspektive bricht mit dem unitären Staatsmodell, indem sie die black box Staat öffnet und den Blick auf die innenpolitische Arena lenkt. Damit gelangen die politischen Entscheidungsprozesse und die konkurrierenden gesellschaftlichen Sicherheitsinteressen - das sogenannte "second image" (Gourevitch 1978; Waltz 1959: 12-13) - wieder in den Fokus. Der Abschied von der Vorstellung des Nationalstaats (oder einer internationalen Organisation) als einheitlich handelnden Akteur macht die Analyse von Sicherheitspolitik einerseits komplexer, öffnet andererseits aber den Blick für die Vielfalt von Akteuren, die über die Formulierung und Ausgestaltung von Sicherheitspolitik mitbestimmen, so zum Beispiel neben der Regierung die Ministerien und deren Administrationen, die Parteien, das Parlament, die Wirtschaft und die verschiedenen zivilgesellschaftlichen Interessengruppen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Die eher starre und unseres Erachtens irreführende Annahme einer über Zeit und Raum stabilen, national homogenen Sicherheitskultur (vgl. Haglund 2011) wird damit überwunden und die Perspektive um die innerstaatlichen, gesellschaftspolitischen Konflikte sowie die Heterogenität der nationalen Sicherheitsinteressen, -kulturen und -praktiken erweitert (vgl. Sperling 2010). Erst die Vorstellung des Staates als vielschichtiger Akteur - auch als ein eigeninteressiertes politisch-administratives, gesellschaftliches Teilsystem, welches wiederum selbst in exekutive und bürokratische Elemente ausdifferenziert ist (vgl. Wolf 2000: 27, 59-60) - erlaubt es, die Interessenkonflikte, Konkurrenzen und Inkompatibilitäten zwischen öffentlichen und privaten Akteuren sowie der Regierung einerseits und der ihr zuarbeitenden Administration beziehungsweise den ausführenden Behörden andererseits wahrzunehmen und zu problematisieren. Die Vorstellung, dass die Gesellschaft primär ein passives Objekt gouvernementaler Regelungshoheit oder nur ein Publikum von Politik ist, stimmt mit der sicherheitspolitischen Realität schon lange nicht mehr überein. Wenn Sicherheitspolitik demgegenüber als security governance verstanden wird (vgl. Daase/Engert 2008), geraten auch die demokratischen Prozesse ihrer gesellschaftlichen (Mit-)Formulierung und damit die unterschiedlichen Sicherheitsbedürfnisse gesellschaftlicher Gruppen - also die agency von unten - sowie Legitimationsfragen genuin demokratischer Sicherheitspolitik (vgl. Daase/Junk 2012; Johansen 1991) wieder in das analytische Blickfeld. Das bedeutet nicht, dass die Regierung künftig als marginalisiert zu verstehen ist oder zu einem reinen Transmissionsriemen der dominanten gesellschaftlichen Interessengruppen reduziert wird. Sie bleibt der wichtigste Akteur im innerstaatlichen Prozess der Aushandlung von Sicherheitspräferenzen, aber eben nicht mehr der einzige. Kurz: Der Staat bleibt souverän, ist aber durch die Demokratisierung der Sicherheitspolitik im Innern nicht mehr autonom und unabhängig von gesellschaftlichen und weltgesellschaftlichen Mitwirkungs- und Mitbestimmungsansprüchen. Nicht übersehen werden darf, dass diese Binnendifferenzierung sich auch auf das Selbstverständnis des Staates auswirkt: Der Staat ist immer mehr gezwungen, seine Position als führender Problemlöser gegen konkurrierende Ansprüche auf verschiedenen Ebenen zu verteidigen beziehungsweise seine Präferenzen und seine Handlungskompetenzen durchzusetzen: erstens intern gegenüber dem Subsystem Verwaltung; zweitens im nationalen Rahmen gegenüber gesellschaftlichen stakeholder, die sich immer mehr in transnationalen Netzwerken zusammenschließen; sowie drittens auch auf der Ebene der Weltgesellschaft gegenüber anderen Staaten oder anders lautenden Präferenzen internationaler Organisationen. Kritisch gewendet könnte man sagen, dass der Staat fortwährend Bedrohungen und Risiken identifizieren und notfalls auch selbst produzieren muss, um im Innenverhältnis seine Legitimität und sein Überleben als zentrale sicherheitstiftende Funktionseinheit zu garantieren (Wolf 2000: 65; Buzan et al. 1998; vgl. bereits Krippendorf 1985, kritisch Münkler 1987). Die Identifizierung von Bedrohungen und Risiken erzeugt Konflikte zwischen Akteuren, die unterschiedliche Werte, Praktiken und Vorstellungen davon besitzen, "was als eine Gefahr anzusehen ist und mit welchen Mitteln ihr begegnet werden soll" (Daase 2012: 40). Sicherheitsbedrohungen existieren nicht einfach oder sind objektiv gegeben, sondern sind zumindest teilweise durch gesellschaftliche Normen und Praktiken intersubjektiv konstruiert. Sicherheitskultur entsteht un...