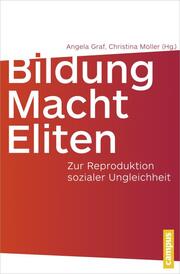Detailansicht
Bildung - Macht - Eliten
Zur Reproduktion sozialer Ungleichheit, Festschrift für Michael Hartmann
ISBN/EAN: 9783593504841
Umbreit-Nr.: 8149907
Sprache:
Deutsch
Umfang: 326 S., div. Abbildungen und Tabellen
Format in cm: 2.1 x 21.3 x 14.2
Einband:
Paperback
Erschienen am 15.11.2015
Auflage: 1/2015
- Kurztext
- Gehören Bildung, Macht und Elite untrennbar zusammen? Der Band vereint Beiträge, die diese Verbindung kritisch in den Blick nehmen. Anknüpfend an die Forschungstradition des Eliteforschers Michael Hartmann steht die Frage nach der Bedeutung der sozialen Herkunft im Mittelpunkt: Welchen Einfluss hat sie auf die Erfolgschancen für höhere Bildung, welche auf den Zugang zu gesellschaftlichen Spitzenpositionen? Welche Rolle spielt der Wirtschaftssektor dabei im gesellschaftlichen Machtgefüge? Die Einzelstudien zeigen, dass zwischen sozialer Herkunft und gesellschaftlicher Macht eine enge Verbindung besteht und soziale Ungleichheiten sich über diese Machtverhältnisse reproduzieren.
- Autorenportrait
- Angela Graf, Dr. phil., ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie an der TU Darmstadt. Christina Möller, Dr. phil., forscht und lehrt im Fach Soziologie an der Universität Paderborn.
- Leseprobe
- Einleitung: Bildung - Macht - Eliten Angela Graf und Christina Möller Bildung, Macht und Eliten stehen in einem engen Zusammenhang. Auf der einen Seite stellt Bildung in Form von Wissen und Bildungszertifikaten eine Grundvoraussetzung für den Zugang zu privilegierten gesellschaftlichen Positionen dar - insofern macht Bildung Eliten. Auf der anderen Seite haben gesellschaftliche Eliten aufgrund ihrer Macht über gesamtgesellschaftliche Entscheidungen und Entwicklungen Einfluss auf Strukturen und Rahmenbedingungen des Bildungswesens und damit auch Einfluss auf die eigene (Re-)Produktion sowie die (Re-)Produktion sozialer Ungleichheiten in der gesellschaftlichen Chancenstruktur. Im Zentrum dieses Sammelbandes stehen Aspekte sozialer Ungleich-heit im Hinblick auf die Zugangs- und Erfolgschancen höherer Bildung sowie auf die (damit zusammenhängende) Positionierung im gesamtgesell-schaftlichen Kontext und insbesondere auf den Zugang zu gesellschaftli-chen Spitzenpositionen. Der Begriff der sozialen Ungleichheit wird hierbei im weiteren Sinne gefasst. Es werden sowohl unterschiedliche soziale Merkmale, die zu einem ungleichen Zugang beziehungsweise zu einer un-gleichen Teilhabe an knappen, gesellschaftlich relevanten Ressourcen füh-ren, als auch unterschiedliche Ungleichheitsdimensionen, nämlich die Chancen- ebenso wie die Verteilungsstruktur in den Blick genommen. Im Zentrum der Betrachtungen steht dabei die Frage nach der Bedeutung und des Einflusses der sozialen Herkunft in diesem Zusammenhang. Diese Schwerpunktsetzung gründet vornehmlich auf den Verdiensten Michael Hartmanns, dem dieser Sammelband gewidmet ist. Er gilt als der bedeutendste Vertreter der kritischen Elitesoziologie in Deutschland. Eine zentrale Fragestellung, der er sich in zahlreichen empirischen Unter-suchungen widmet(e), ist die Bedeutung der sozialen Herkunft für den Zugang zu gesellschaftlichen Spitzenpositionen und die Rolle des Bil-dungssystems in diesem (Re-)Produktionsprozess gesellschaftlicher Macht-verhältnisse (vgl. u. a. Hartmann 1996; 2002; 2007; 2013). Damit stellt er sich kritisch gegen den gesellschaftlichen Glauben an das meritokratische Prinzip, nach dem Leistung als ausschließliches Allokationskriterium für gesellschaftliche Positionen und damit auch für den Zugang zu Spitzenpo-sitionen fungiert. Dieses Leistungsparadigma ist in unserer heutigen Gesellschaft tief verankert und besitzt legitimatorische Funktion, wobei soziale Ungleichheiten, insbesondere die Bedeutung der sozialen Herkunft, ausgeblendet werden. Zur Verschleierung ungleicher Chancenstrukturen trägt auch das Bildungssystem in nicht unerheblichem Maße bei, so seine in Anlehnung an Pierre Bourdieu und andere kritische Elitesoziologen vertretene These. Diese legitimatorische Funktion der meritokratischen Illusion wird unter anderem gestützt durch die Folgen der Bildungsexpansion. Die prinzipiellen Zugangsmöglichkeiten zu höheren Bildungsinstitutionen führten zweifellos zum partiellen Abbau sozialer Chancenungleichheiten. So konnten Frauen einen Gutteil ihrer strukturellen Benachteiligung im Bildungswesen wettmachen. Gleichzeitig weisen andere Momente sozialer Ungleichheit aber, und dies gilt insbesondere für den Aspekt der sozialen Herkunft, erhebliche Beharrungstendenzen auf - wie jüngst an den Ergebnissen von PISA, IGLU und anderer Studien sichtbar wurde. Die Selektionsmechanismen, die zu diesen ungleichen Verteilungsstrukturen führen, sind hochgradig subtil und tragen daher zum Mythos einer rein auf Leistung basierenden Auslese bei. Während die Geschlechterkategorie insbesondere im Hinblick auf un-gleiche Teilhabechancen an beruflichen Spitzenpositionen zum Politikum avancierte, da Frauen in allen einflussreichen Positionen, vor allem aber in Elitepositionen, nach wie vor eklatant unterrepräsentiert sind, ist der Einfluss der sozialen Herkunft bislang vor allem Gegenstand des sozialwissenschaftlichen Diskurses. Dass in Deutschland starke herkunftsspezifische Bildu